|
|
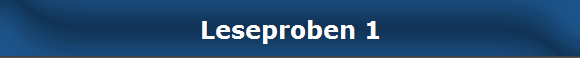 |
|
|
|
Anspruch auf Mündigkeit
Wallenstein „Im April 1625 schickt Wallenstein die ersten Werbeoffiziere aus. Ende Juni ist die Nominalstärke des Heeres erreicht, Wallenstein stoppt die Werbungen, Fürs erste zumindest. Nominalstärke - das heißt, die Ziffern der Werbelisten haben die vorgesehene Gesamtzahl erreicht. Bis das Heer wirklich zur Verfügung steht, und zwar in seiner vollen Stärke, dauert es noch Wochen. Ein neues Regiment entsteht damals so, daß zunächst Lauf- und Musterplätze bestimmt und genehmigt werden. Die Werbeoffiziere — Hauptleute, Rittmeister, oft die Obristen selber - ziehen in diejenigen Gebiete, die zur Werbung vorgeschrieben oder für sie genehmigt worden sind. Dort, in den Dörfern und Städten, erfolgt das Umschlagen: Die Werber ziehen unter dem Schlag der Trommel auf, rufen die Einzelheiten ihrer Werbung aus und nennen die Bedingungen des Dienstes. Nimmt jemand den Werbegulden an, dann hat er »seine Haut« verpfändet, das ist wörtlich gemeint. Man ist nicht zimperlich, es ist die Ehrlichkeit eines hochstehenden Materialismus. Forderung und Belohnung sind absolut greifbar, es gibt kein Mißverhältnis der Abstraktionsverschiebung, der Kriegsherr verlangt für konkreten Lohn von seinen Söldnern konkrete Taten, konkreten Einsatz, das heißt auch das selbstverständliche Risiko konkreter Schmerzen und Wunden. Erst spätere Zeiten, die sich an allgemeinen Ideen orientieren, belohnen ihre Soldaten nicht mehr mit Geld, sondern mit Ideen: der Zukunft, dem Vaterland, dem Staat. Man soll faktisch sterben, um symbolisch zu leben. Die Söldner des 17. Jahrhunderts wissen, daß man sie für ihre Haut bezahlt. So strömen sie ohne falsche Erwartungen auf den Laufplätzen zusammen, erhalten zunächst den Werbegulden und ein Handgeld, das sogenannte Laufgeld; die Kavalleristen das Anrittsgeld. Dann ziehen die Söldner in kleineren Gruppen zum Musterplatz, auf dem die Regimenter nach der Musterung zusammengesetzt werden. Der Kriegsknecht - so heißt der Soldat seit Frundbergs Zeiten - wird bei der Musterung auf die Fahne vereidigt, der Artikelsbrief wird verlesen, also das Kriegsrecht bekanntgegeben; von diesem Moment an, erst nach abgelegtem Eid, untersteht er der Regimentsjustiz. Der Weg vom Laufplatz zum Musterplatz ist nicht nur der Marsch unter die Fahne, er ist auch die letzte Freiheitsspanne des angehenden Soldaten, und dieser Weg sieht entsprechend aus. Deshalb hat der Hofkriegsrat schon vor Jahren den strikten Befehl erlassen, daß die Knechte nur in Gruppen von höchstens acht bis zehn Mann zum Musterplatz ziehen dürfen: ein Befehl, der durch die ganzen Jahre in Kraft ist, wiederholt aufgefrischt wird und den die Knechte genauso selten befolgen wie die andere strikte Weisung, daß auf diesem Marsch »die Untertanen nicht bedrängt« werden dürfen. Lauf- und Musterplätze sind in ganz Europa der helle Schrecken der Bevölkerung. Reichere Städte versuchen, sich mit hohen Geldsummen von einer Bestimmung als Musterplatz loszukaufen. Im Verlauf des Krieges führt man die Werbungen mit immer fragwürdigeren Mitteln durch. Mit Geld, das ist ganz reell. Mit Versprechungen auf Kriegsbeute — als pauschaler Köder ein illegitimes Verfahren, da der Feldherr nur von Fall zu Fall Plünderungserlaubnis geben darf und die Beute geschlagener Heere nach einem festen Prozentsatz aufgeteilt wird, wenigstens dem Buchstaben nach. Zögernde werden betrunken gemacht und dann verpflichtet; von da bis zur Erpressung, Nötigung, zum Zwang ist es nicht weit, vor allem, als kriegstaugliche Männer immer seltener werden. Ebenso wird es bald Brauch, daß Offiziere mit Werbepatenten dort auftauchen, wo eventuell ein Regiment, das ein Fürst nicht mehr braucht, abgemustert wird, um »den Flor« desselben, wie der Ausdruck heißt, ins eigene Lager abzuziehen, öfters treten ganze Kompanien oder gar Regimenter einfach in fremden Dienst über. Als Mansfeld und der tolle Halberstädter dicht bei der französischen Grenze operieren, meutern plötzlich 2000 Reiter Christians, weil sie zu lange nicht entlohnt worden sind. Sie lösen sich auf, ein Teil geht nach Hause, ein Teil nimmt spanische Dienste an. Christian hat das nicht erheblich gestört, er gehört schon einer anderen Zeit an - im Vergleich zu Frundsberg nämlich. Als im März 1527 seine Soldaten bei Bologna wegen rückständiger Löhnung meutern, trifft den »Vater der Landsknechte« der Schlag, er stirbt an den Folgen. Klagen der Obristen, daß sie ihrer Truppen nicht mehr mächtig seien, gehören nicht zu den Seltenheiten. Am übelsten sind die Söldner im Dienst des Papstes angeschrieben. 1622 soll ein päpstliches Regiment die kaiserlichen Truppen verstärken, aber Erzherzog Leopold muß seinem kaiserlichen Bruder schreiben, das Regiment sei so schlecht, »daß wir es bis dato in keiner Occasion vor den Feind ziehen lassen oder sonst brauchen konnten«. Auch Wallenstein lehnt einmal die Verstärkung durch päpstliche Truppen rundweg ab, von ihnen hält er noch weniger als von den spanischen Soldaten: »Im Fall, daß der Bapst Kriegsvolk will schicken, so nimb man's nicht an ... Will der Bapst etwas bei diesem Wesen tun, so gib er Geld und sein Kriegsvolk sampt seinen Indulgenzen behalte er zurück. Mir ist lieber, wenn er mir alle Monat 5000 Kronen gibt, als wenn er mir 5000 Mann bezahlt, denn hab ich des Monats 5000 Kronen, so schaff ich dem Kaiser mehr Nutz als mit 5000 Italienern. « Disziplinlosigkeit und Unzuverlässigkeit sind nicht nur typische Merkmale des einfachen. Soldaten. Bei den Offizieren sieht es kaum besser aus. Der Hauptgrund: es gibt damals noch keinen besonderen Offiziersstand. Die Söldnerheere, wie sie seit Maximilian I. bestehen, sind immer nur Gelegenheitstruppen, die je nach der militärischen oder politischen Lage von heute auf morgen aufgelöst werden. Noch in den ersten Jahren des Dreißigjährigen Krieges wird oft jeder als Offizier bezeichnet, der nicht zu den gemeinen Soldaten gehört, also zum Beispiel auch der Trommler, der Spielmann, mit dem die Werbeoffiziere durch das Land ziehen. Je stärker im Verlauf de» Krieges das Niveau des gewöhnlichen Soldaten sinkt, um so größer wird das Gewicht, das die Heerführer auf gute Offiziere legen, und erst dadurch verwandelt sich ihre Stellung allmählich in einen Stand. Feste Rangabstufungen gibt es kaum. Wenn ein Fürst ein Heer braucht, ernennt er irgendeinen Kriegsmann, der ihm geeignet erscheint, zum Feldhauptmann und beauftragt ihn mit der Anwerbung der Truppen. Der Feldhauptmann sucht sich auf eigene Verantwortung bewährte oder bekannte Leute, die er zu Obristen ernennt und bestallen läßt; von den unteren Chargen bestimmt er diejenigen Offiziere, die als Werber durch die Länder ziehen, meistens haben sie den Rang von Hauptleuten. Eine Art Institution werden die Werbeoffiziere erst sehr spät. Strenge Regeln dafür gibt es im Dreißigjährigen Krieg noch nicht, oft haben die ernannten Obristen selbst für die Aufstellung der Truppen zu sorgen. Ein Oberst im Feld ist immer auch Führer eines Regiments. Er wählt sich aus den Hauptleuten seinen Stellvertreter, den Oberstleutnant. Die Hauptleute ihrerseits können ebenfalls frei ihren Stellvertreter bestimmen, den Leutnant, sie können auch einen von den Doppelsöldnern dazu ernennen. Die Söldner schließlich bestimmen ganz demokratisch einen aus ihren Reihen zum Feldwebel. Mit der steigenden Straffung der Heeresführung gehen allerdings diese Momente und Elemente der Freizügigkeit mehr und mehr verloren. Jeder, der mit einer Sturmhaube, mit Schwert und Spieß zum Werbeplatz kommt, wird einfacher Söldner. Später ist keine Bewaffnung mehr nötig, im Dreißigjährigen Krieg werden die Waffen bald ausnahmslos von den anwerbenden Fürsten gestellt, ebenso die Kleidung. Wer eine Hakenbüchse besitzt oder sich auf eine andere, vorteilhafte Weise vom einfachen Soldaten unterscheidet und heraushebt - durch längere Dienstzeit, Kriegserfahrung, erwiesene Tapferkeit, edlere Abstammung —, wird Doppelsöldner, er darf doppelten oder überhaupt höheren Sold beanspruchen. Diese Landsknechtstraditionen gehen im Dreißigjährigen Krieg rasch unter, selbst die Bezeichnung Doppelsöldner verschwindet; statt dessen entsteht das Verhältnis des einfachen Pikeniers, eines Soldaten zweiter Güte gegenüber dem Musketier. Das hängt vor allem mit der Entwicklung der Waffentechnik zusammen und nicht so sehr mit der veränderten Kampfführung; die Musketiere wachsen im Lauf der Zeit auf die doppelte Zahl der Pikeniere an, trotzdem bleiben die Pikeniere als Kämpfer mit der blanken Waffe für Sturmangriffe und zur Abwehr von Kavallerieattacken unentbehrlich. Die kleinste Einheit ist das Fähnlein, der Heerhaufe, der sich um eine Fahne schart. Das Fähnlein wird später nur noch Kompanie genannt; bei den Reitern heißt die entsprechende Einheit Kornett, die Bezeichnung kommt aus dem Spanischen: corneta, die Reiterfahne, Standarte. Später wird die gleiche Einheit Eskadron oder Schwadron genannt. Die Zahl des Fähnleins schwankt bei den Fußtruppen anfangs zwischen 300-500, bei den Reitern pendelt sie zwischen 100 und 150. Diese Zahlen sinken mehr und mehr ab. Fünf bis zehn Kompanien bilden ein Regiment. Weil die' Stärkeziffern niemals verbindlich sind, ist für die verschiedenen Kräfteverhältnisse der Heere die Gesamtzahl der Soldaten aufschlußreicher als die Zahl der Regimenter oder Kompanien. Da eine strenge Chargen- und Rangabstufung noch nicht existiert, haben auch die Offiziere sehr unterschiedliche Funktionen. Ein Oberst kann Generalsdienste leisten, umgekehrt sind alle Generale immer auch gleichzeitig die Obristen derjenigen Regimenter, die sie selbst geworben haben. Aus diesem ganzen lockeren System ergibt sich fast selbstverständlich, daß auf Beförderungen nicht der geringste Anspruch besteht, etwa aus Gründen der Anciennität. Maßgebend allem ist das Verdienst. Das kann eine militärische Leistung sein: Tapferkeit, Besonnenheit, Glück, Kaltblütigkeit, Erfolg. Es kann aber genausogut eine besondere Werbungsleistung sein. Dem obersten Feldhauptmann steht es frei, demjenigen einen Offizierstitel zu verleihen und vom Fürsten bestätigen zu lassen, der durch große Geldsummen Truppenwerbungen ermöglicht hat. Alle Ernennungen und Beförderungen sind einzig und allein Sache des Feldhauptmanns. Nicht einmal der Kaiser kann von sich aus jemanden zum Offizier im Heer des Feldhauptmanns ernennen. Das heißt: er kann es natürlich, er kann ein Patent erlassen. Aber wenn so ein auf dem Papier ernannter Oberst im Feldlager auftaucht und nicht sein eigenes Regiment mitbringt, muß er damit rechnen, daß sich kein Mensch um ihn kümmert. Derartige Ernennungen oder auch nur Empfehlungen sind mit die schlechteste Form, in der sich jemand bei einem Feldherrn einführen kann. Vor allem Wallenstein hat eine unglaubliche Abneigung gegen Leute, die mit solchen kaiserlichen Empfehlungen oder Patenten im Feldlager auftauchen, für den Feldherrn oder den Regimentsobristen ist eine siegreiche Schlacht, ein erfolgreiches Gefecht oder Scharmützel der natürliche Moment für Beförderungen. Das häufigste, elementarste Motiv ist auffallende Tapferkeit. Militärische Tugenden sublimerer Art sind auf ein entsprechendes Urteilsvermögen der höheren Charge angewiesen; damit steht es im Dreißigjährigen Krieg nicht allzu gut. Auf die Offiziersschicht wirkt sich das besonders stark aus. Was da bei den Hauptleuten und höheren Rängen allmählich an Haudegen zusammenkommt, ist womöglich noch brutaler und vulgärer als der gemeine Soldat. Daß viele unter den besten, das heißt kriegserfahrensten Offizieren als Pferdeknechte angefangen haben, ist damals etwas ganz Selbstverständliches. So macht sich wohl oder übel im Lauf der Kriegsjahre unter den Offizieren auch nicht viel weniger Gesindel breit als bei den einfachen Söldnern ohne Charge und Rang. Am schlimmsten ist es bei den Hauptleuten, allerdings verfließen die Differenzen zwischen den Obristen und den Hauptleuten glatt und ohne Schwierigkeit. Das häufigste Delikt ist, die Truppenminderung durch Schlachtentod, Krankheit oder Desertion nicht anzugeben, Sold und Verpflegung für die kompletten Fähnlein oder gar in Regimentsstärke einzufordern und den Überschuß in die eigene Tasche wandern zu lassen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob man im Feld steht oder als Besatzung im fremden oder auch eigenen Land liegt. Es macht auch keinen Unterschied, ob die Bauern katholisch sind oder protestantisch, ob sie zum Freund oder Feind zählen. Die Söldner hausen meistens in allen Ländern auf die gleiche üble Weise. Der Hofkriegsrat muß 1620 einen Befehl erlassen, daß die Bauern in der nächsten Umgebung Wiens ihre Zufuhren nicht mehr in Einzelgespannen zur Stadt bringen dürfen, weil die Unsicherheit zu groß geworden ist, und zwar die Unsicherheit durch die Einquartierung kaiserlicher Truppen. In einer Klageschrift der katholischen Stände von Niederösterreich aus dem gleichen Jahr wird nach der Aufzählung einer fast endlosen Kette von Untaten resigniert festgestellt: »Die Wallonen im kaiserlichen Dienst hausen so, daß auch die vor Christi Geburt gestorbenen Heiden eine Scheu darob gehabt hätten.« Die Soldaten graben sogar Särge aus und verkaufen sie, wenn sie aus Blei oder Zinn sind. Die verantwortlichen Heerführer haben meistens schon aus ureigenstem Interesse mit allen Mitteln versucht, Ordnung unter den Truppen zu halten. Tilly ist berühmt für seine Strenge, mit der er auf Disziplin achtet. Er wird darin von Wallenstein noch weit überboten. Daß es bei Mansfeld und dem Halberstädter anders aussieht, hängt einerseits mit den Persönlichkeiten dieser Armeeführer zusammen und andererseits mit der Hauptwurzel des ganzen Übels, das sich mit dem Namen »Soldateska« damals verbindet, dem Geld, oder besser gesagt: dem fehlenden Geld. 1621, als die ligistischen Truppen im Raum um Nürnberg den Regimentern Mansfelds gegenüberliegen, werden an einem einzigen Tag acht Soldaten aufgehängt, wie Maximilian dem Kaiser berichtet. Wallenstein ist mit dem Aufhängen noch schneller zur Hand. Es hilft, aber nicht viel. Das ist ein seltsames Bild: Die Züge dieser gewaltigen Heerhaufen über die Straßen des Reichs, links und rechts geplünderte Häuser, brennende Scheunen, ausgeraubte Vorratslager und daneben an den Bäumen die Galerien aufgehängter Soldaten, die in flagranti erwischt wurden. Und als Steigerung noch der Schrecken, der sich an solche Heere wie des Grafen Mansfeld knüpft, ein Schrecken, der so groß ist, daß ihn Mansfeld tatsächlich als militärisches Mittel einsetzt. Nichts ist für Mansfeld charakteristischer als sein Schreiben an den Herzog von Lothringen vom 3. Juli 1625, der alles andere als sein Feind war. Mansfeld meldet dem Herzog den Zuzug seiner Truppen und bittet ihn, seinen Untertanen zu befehlen, »ihre besten Sachen in wohlverwahrte Orte zu bringen, diese genugsam verbollwerken und sie mit Leuten zum Schutz versehen, damit, wenn es zum Angriff meines Kriegsvolks kommt, sie Widerstand leisten können«. Denn, so teilt Mansfeld dem Herzog lakonisch mit, seine Soldaten dürften sich wegen der schlechten Bezahlung überaus große Freiheiten erlauben und alle möglichen Exzesse begehen, ohne daß er etwas dagegen unternehme. Keiner ist hier zynischer gewesen als Mansfeld, der sich nicht geniert hat, bei Werbungen den Soldaten zu sagen, auf Entlöhnung dürften sie nicht rechnen, dafür aber auf maximale Beute aus Plünderungen und Brandschatzungen. Hier wird genau der Punkt berührt, der gerade damals der springende Punkt gewesen ist und eine alles überragende Bedeutung hat, die Geldfrage. Daß man das in der Geschichtsschreibung dieser ganzen Zeit so lange unterschätzt hat, ist eine besonders ideale Sünde der Historiographie. Die Mißachtung des Geldproblems hat ebenso mit dazugeführt, Wallensteins Rolle zu verkennen. Von wo man auch ausgeht, von welchen Zusammenhängen auch immer, bald genug taucht die Geldfrage bei Wallenstein auf. Das gehört nun einmal zu seiner geschichtlichen Bedeutung, daß er - als eine der großen Ausnahmen der damaligen Zeit - völlig die Rolle begreift, die dem Geld zufällt, und zwar in einem weit höheren Maß als noch wenige Jahrzehnte früher. Für Wallenstein ist es so selbstverständlich wie nur möglich, «laß Geld nicht nur den nervus rerum auch der politischen und religiösen Dinge ausmacht, sondern daß auch für den einzelnen, sofern er sich mit den öffentlichen Dingen der Welt einläßt und in ihrem Getriebe handelt, Geld der sechste Sinn ist, der vorhanden sein muß und ohne den die restlichen fünf Sinne sich nicht voll entfalten können. Mit dem Geldproblem, mit der Frage, wie die Mittel zur Durchführung der großen politisch-militärischen Projekte aufzubringen sind, ist schließlich auch die Zäsur verknüpft, welche durch die Aufstellung der Armee Wallensteins für die damalige Zeit gesetzt wird - eine Zäsur für das Heereswesen, für den Dreißigjährigen Krieg, für die damalige Geschichte und ihren Verlauf. Das Jahr 1625 trennt zwei verschiedene Epochen. Hofkriegsrat und Kaiser wissen, daß die Ordnung in der Truppe vor allem von der Bezahlung abhängt. 1621 betont Ferdinand II. in einem Schreiben an die katholischen Stände, daß sich die wilden Plünderungen der Soldaten am schnellsten abstellen ließen, wenn sie ordnungsgemäß entlöhnt würden; sei das nicht der Fall, könne man den Truppen ihr Verhalten nicht ohne weiteres verdenken. Deshalb gebe er den huldvollen Rat, die Kriegsknechte korrekt zu entlöhnen. Das eine ist der Rat, das andere sind die Gelder. Und es gibt nun einmal 1621 kein Geld für den Sold. Es gibt auch kein Geld für die Verpflegung. Jeder Troßjunge und jeder Fuhrknecht der Armee weiß, daß der Dienst umso strenger und straffer sein kann, je höher der Sold, je besser die Verpflegung ist. Im kaiserlichen Heer hängt diese Frage vom Zu stand der habsburgischen Finanzen ab. Er ist seit Ferdinands Thronbesteigung katastrophal, daran ändern auch die Jahre 1622 und 1625 nichts, in denen das Experiment der langen Münze durchgeführt wird und Böhmen unter den Hammer kommt. Die Kosten für den jährlichen Unterhalt eines Fußregiments werden grob auf 400—450 000 Gulden geschätzt, für ein Reiterregiment auf 260—300 000 Gulden. Für die Anwerbung, Aufstellung und Abdankung werden einheitlich pro Regiment 135 000 Gulden veranschlagt. Vom August 1618 bis zum Juni 1619 betragen die Gesamtkosten für die kaiserlichen Regimenter samt Artillerie und Verpflegung 5 Millionen Gulden. Das Budget samt allen spanischen und päpstlichen Subsidien weist im gleichen Zeitraum nur 3 Millionen auf. Krieg ist noch in weit höherem Maß als Politik in Friedenszeiten ein Vorsorgeproblem. Deshalb steht Ende Mai 1619 im Wiener Hofkriegsamt nicht der Differenzbetrag von 2 Millionen als Schuld an, sondern auf Grund von Darlehen und Soldrückständen mehr als das Doppelte, nämlich 4 309 000 Gulden. Die Kriegslasten steigen von Jahr zu Jahr unaufhaltsam. In den beiden ruhigen Jahren 1624 und 1625 müssen Bayern und die geistlichen Fürsten allein für den Unterhalt des ligistischen Heeres 4,5 Millionen Gulden aufbringen. 1627 zählt das ligistische Heer 27 000 Mann. Ein Archivbeleg dieses Jahres zeigt, daß für 15 000 Mann zu Fuß und 7000 Reiter monatlich 216 500 Reichstaler erforderlich sind - ein deutlicher Index für die Schnelligkeit, mit der die Ausgaben gegenüber 1624 und 1625 in die Höhe klettern. Die Liga muß um 30 Prozent mehr aufbringen, das ergibt sich ganz natürlich aus der Kriegslage, und es kommt noch dazu, daß in dieser Zeit die Hauptlast der Kämpfe gar nicht auf den Schultern der Ligisten liegt, sondern auf den Schultern Habsburgs. Je länger die Auseinandersetzungen dauern, um so intensiver umwirbt man die Soldaten, um so höher steigen Werbegulden, Lauf- und Anrittsgeld, Monatssold, und zwar ohne daß deshalb auch die Disziplin der Regimenter automatisch mit steigen würde. Im Gegenteil. Geld verändert sich aus einer Zuchtrute in die Wünschelrute der Disziplin. Die meisten Meutereien entstehen wegen rückständigen Solds. Die roten Ziffern werden zum Alptraum aller Kommandeure. Im Sommer 1620 geht das Regiment des Grafen Thurn in offenen Aufruhr über, um sich endlich Bezahlung zu erzwingen. Thurn und die Offiziere retten sich fürs erste so, daß sie bei den Marketendern des Regiments Geld für die Soldaten borgen. Dann stürzt Thurn verzweifelt nach Prag, um die Direktoren um Geld anzuflehen, ein Freund von ihm erzählt, »daß er wie ein Kind geweint und den Untergang seines Vaterlandes — der bei der bösen Bezahlung des Kriegsvolks und dem üblen Regiment gewiß folgen müßte - gar schmerzlich beklagt«. Einige Monate später ist es soweit. Mansfeld hat kein Direktorium, an das er sich wenden kann. Als damals auch seine Soldaten meutern, hat er keine Zeit, tränend irgendeinen bevorstehenden Untergang zu beklagen, höchstens seinen eigenen. Die Söldner ziehen in sein Quartier und wollen ihn so lange festsetzen, bis er die Rückstände bezahlt. Mansfeld reißt die Tür auf, mit einem Schweizerdegen in der Faust, er springt mitten unter die Meuterer, haut zwei von ihnen nieder und verwundet mehrere; der Rest flieht. Kurz darauf rotten sich die Soldaten wieder auf den Gassen zusammen und rücken vor das Haus Mansfelds. Jetzt hat Mansfeld drei seiner Hauptleute bei sich, sie werfen sich zu Roß in die Haufen, schießen und hauen in die Rebellen, neun Söldner bleiben tot am Platz, sechsundzwanzig sind verwundet. Aus Prag kommt am Abend Unterstützung. Von diesem Tag an hat niemand mehr unter Mansfeld gemeutert, die Soldaten geben sich mit der Art seiner Entlohnung - von Zeit zu Zeit, schubweise — zufrieden. Für den gemeinen Söldner wird der Krieg zum Geschäft. Wer zahlt am höchsten? Wo gibt es die beste Verpflegung? Wer drückt beim Plündern die Augen am stärksten zu? Das sind, neben den Tagen des Kampfes selbst, die einzigen Fragen, welche die Gemüter und im Zweifelsfall die Beine der Soldaten bewegen. Viele Truppenführer ersetzen schließlich wie Mansfeld den baren Sold immer häufiger durch Versprechungen und Aussichten auf eine hohe Beute. Tilly ist auch bald soweit, aber die Liga hilft nicht, und Ferdinand kann nicht helfen. Die finanzielle Lage Habsburgs läßt sich gar nicht schwarz genug malen, denn sie ist in Wirklichkeit noch viel dunkler gewesen. Was nützt da die Erinnerung an Kaiser Karl V., der seine wichtigste und größte Schlacht, die grandiose Umfassungsschlacht von Pavia 1525 aus reiner Hilflosigkeit schlägt; denn seine Söldner wollen schon auseinanderlaufen, weil Karl sie nicht bezahlen kann, er hetzt sie in den Kampf, sie siegen - und zerstreuen sich jetzt, nach dem Sieg, in alle Winde. Zwei Jahre später wird die Katastrophe dieses Sieges noch überboten, das kaiserliche Heer hungert, es ist seit einer geradezu endlosen Zeit ohne Sold, die Landsknechte entschließen sich zum Sturm auf Rom, sie fällen die Spieße sogar gegen ihren Halbgott Frundsberg, er weicht, und jetzt flammt der grauenvolle Sacco di Roma über die Bühne des Jahrhunderts - ein »Gottesgericht«, weil der Sold aussteht. Vor diesem Hintergrund der schauerlichen Geldnot Habsburgs steht nun die Offerte Wallensteins, auf eigene Kosten eine Armee aufzustellen. Alle, die von der Sache nur entfernt etwas verstehen, wissen, daß es mit der Verpflegung und dem Sold allein nicht getan ist, daß Bekleidung und Waffen dazugehören, Wagen und Zelte, Munition und Kriegsgerät. Der Troß der damaligen Heere wächst allmählich zu monströsen Umfangen an, nebenbei eine der Hauptursachen für die Schwerfälligkeit und Trägheit der Truppenmassen. Die Zahl der Troßleute kommt oft bis nahe an die Zahl der Soldaten heran, manchmal übersteigt sie sogar die Ziffern der Kampfeinheiten. Wenn ein derart gigantischer Körper, ein Heer von vielen tausend Mann funktionieren soll, sind Millionen von Gulden notwendig. So finanzstark Wallenstein auch eingeschätzt wird, so ist es doch für einen Privatmann unmöglich, diese Millionen allem, aufzubringen. Das weiß der Kaiser genausogut wie die Hofkammer, und Wallenstein hat niemals Andeutungen in diese Richtung gemacht. Trotzdem stellt er eine solche Armee auf. In den Annalen Khevenhüllers tritt sie zum erstenmal auf, und sie ist bis in die jüngste Zeit immer wieder neu ausstaffiert worden, ohne allzuviel an Faszination zu verlieren, diese Legende, die in den Januar 1625 plaziert wird. Khevenhüller berichtet in seinen »Annales Ferdinande!« wörtlich folgendes: »Weil aber die Länder schon viel gelitten hatten, denselben überdies nicht zu trauen war, die Kammergefälle erschöpft und allenthalben angestanden, schlug letztlich Albrecht von Wallenstein ein Mittel vor, wie Ihre kaiserliche Majestät ein mächtiges Kriegsheer auf die Beine bringen und viele Jahre unterhalten möchten. Er müßte aber hierzu in 50 000 Mann zu Roß und Fuß haben. Und als die kaiserlichen ministri diesen Vorschlag für desperat gehalten und darauf geantwortet: Wenn man nicht Mittel hätte, 20 000 zu werben und zu maintenieren, wo solle man gar 50 000 aufbringen und bezahlen? Darauf hat er repliziert: Mit 20 000 Mann könnte er ja die Länder und wo er hinkomme, nicht in Kontributionen setzen, wohl aber mit 50 000 Mann. Darauf wurde mit ihm abgeschlossen, daß er erstlich 20 000 Mann und hernach das übrige werben solle. « Dieser Bericht ist falsch. Und er ist doch auch nicht ganz falsch. Die Mitteilung Khevenhüllers muß durch ein anderes Dokument ergänzt werden. Am 17. November 1625 gibt der Kaiser einen »öffentlichen Brief« aus, eine Assekuration für Wallenstein, in der Ferdinand II. ausdrücklich sagt, daß Wallenstein für die neue Armee »die darauf gehende Spesa, Uns zu gehorsamsten Ehren, auf sich genommen, was wir solches nicht allein zu gnädigstem Gefallen vermerket, sondern auch Ihro die Wiedererstattung dessen, so Sie in diesen Unseren Diensten unentbehrlich aufwenden werden müssen, gnädigst zugesagt und versprochen haben«. Hier schreibt der Kaiser klar und bestimmt, daß Wallenstein sich verpflichtet hat, für die Spesa, die Kosten für die Armee, aufzukommen. Hat sich Wallenstein also nicht nur zur Werbung und Ausrüstung verpflichtet, sondern hat er auch den laufenden Sold und die Erhaltung der Truppe übernommen, aus eigener Tasche, solange das Heer überhaupt gebraucht wird? Wallenstein ist sicher ein Finanzierungsgenie, aber daß er aus eigenen Mitteln nur einen Teil der Kosten aufbringen kann, die dafür notwendig sind, das muß er den Hofräten in Wien nicht beweisen, das nehmen sie ihm ohne Skepsis ab. Um den Privatsäckel geht es auch nicht. Wallenstein ist ein viel zu ausgeprägter Realist, als daß er dem Kaiser für nichts _und wieder nichts vorschlagen würde, einfach Millionen Gulden Kriegskosten privat zu übernehmen, nur weil er im Moment nichts Besseres zu tun hat. … „
Anspruch auf Mündigkeit Die Medici In den Familien der Este und Visconti, der Sforza und Borgia und ihren überragenden Persönlichkeiten verbindet sich Individuelles und Exemplarisches zu einem Phänomen der Epoche, dem die argumentierende Erklärung nur zum Teil gerecht werden kann. Noch weit schwieriger wird es bei den Medici, die gegenüber den anderen illustren Dynastien erneut eine Kategorie für sich bilden: unvergleichlich in einem betont gefühlsarmen Sinn und trotzdem durch und durch repräsentativ. Die Medici heben sich in diesem ganzen Jahrhundert durch ihre unbestrittene Excelsität ab. Über den Staat, der dazu gehörte, das Florenz ihrer Zeit, sagte Jacob Burckhardt in zwei Sätzen: »Die höchste politische Bewußtheit, den größten Reichtum an Entwicklungsformen findet man vereinigt in der Geschichte von Florenz, welches in diesem Sinne wohl den Namen des ersten modernen Staates der Welt verdient. Hier treibt ein ganzes Volk das, was in den Fürstenstaaten die Sache einer Familie ist. « Dieses Urteil wird man ergänzen müssen. Florenz hätte ohne die Medici seinen Ausdruck nicht gefunden; andererseits personalisiert sich in ihnen vollständig der »wunderbare florentinische Geist«, von dem Burckhardt ebenfalls spricht. Sicherlich, auch Dante und Machiavelli waren Florentiner, der größte Dichter und der entschiedenste politische Denker. Aber in einem Mann wie Lorenzo de' Medici war beides gleichermaßen vorhanden. Deshalb stellte Machiavelli sachlich fest: »Sein politisches Können macht Florenz zum führenden Staat, sein Kunstsinn zum geistigen, künstlerischen und gesellschaftlichen Mittelpunkt von Italien. « In der Geschichte wird sich keine Familie finden, die für die bildende Kunst, für Literatur, Philosophie und Wissenschaft mehr bedeutet und geleistet hat als die der Medici, und zwar nicht auf Kosten großer Bevölkerungsschichten, sondern unter der Devise: Das Wohlergehen aller ist die Bedingung für eine größtmögliche Entfaltung der geistig-künstlerischen Potenzen.
Die ersten Daten über die Medici stammen von 1201. Chiarissimo de' Medici wird als Mitglied des Consiglio del Commune, des öffentlichen Rates, erwähnt; sein Reichtum und Einfluß hielten sich noch in mittleren Grenzen. Hundert Jahre später hatten die Nachkommen sich bereits nach vorn geschoben, da wurde Averardo di Bicci de' Medici zum Gonfaloniere von Florenz gewählt, zum Haupt der Signora die sich aus den vornehmsten Zunftmeistern der Stadt zusammensetzte. Ein weiteres Jahrhundert danach stand die Familie neben den rivalisierenden Albizzi an der Spitze des Gemeinwesens. Ihr Reichtum hatte dieselbe Basis wie der Wohlstand von ganz Florenz: Er beruhte auf der Textilfabrikation, der Verarbeitung von Wolle, ihrer Veredelung und auf neuartigen Einfärbungsmethoden. Dazu kamen ausgedehnte Bankgeschäfte, Handelsunternehmen und die Bewirtschaftung großer Landgüter. 1421 wurde wiederum ein Medici zum Gonfaloniere gewählt: Giovanni di Bicci de’ Medici. Er galt als der reichste Bürger der Stadt. Bei den anderen einflußreichen Parteien und Familien war er nicht beliebt, aus eigener Schuld; denn er setzte eine Steuerreform durch, die zwar seit langem fällig, aber für die damaligen Zustände verhältnismäßig radikal war. Im alten System hatte man Reiche und weniger Reiche nahezu schematisch gleich besteuert, die Besitzenden also begünstigt. Giovanni di Bicci drückte nun statt einer Belastung des Einkommens eine Besteuerung des Vermögens durch und führte eine öffentliche Kontrolle der Steuererklärung ein. Damit machte er der Methodenwillkür bei der Steuereintreibung ein Ende. Er setzte auch das erste große Zeichen für das weltgeschichtlich gewordene Mäzenatentum der Medici. Denn er war es, der Donatello forderte, der Filippo Brunelleschi dazu anspornte, die Kuppel des Doms zu vollenden. Ein Jahrhundert lang hatte der Bau stillgelegen, niemand hatte sich an das letzte Stück gewagt, weil es noch keine Erfahrungen gab, ob eine solche Riesenkuppel ungestützt technisch zu verwirklichen war. Brunelleschi riskierte den Bau. Die Höhe der Kuppel der Kathedrale Santa Maria del Fiore beträgt einundneunzig Meter. Als sie fertig war, kam der Papst persönlich, begleitet von sieben Kardinalen und siebenunddreißig Bischöfen, nur zu dem Zweck, dieses absolute Bauwunder der damaligen Zeit anzustaunen. Im Jahr 1429 starb Giovanni di Bicci. Sein knapp vierzigjähriger Sohn Cosimo übernahm die Familienführung. Er wurde für die Verwaltung des größten Vermögens in der Toskana verantwortlich; denn er besaß das einträglichste Kaufmannsgeschäft des Staates. Sein Reichtum wurde nur noch von den Peruzzi übertroffen, den gewieftesten Bankiers des Landes neben den Bardi. Die Geldsumme seines Vermögens soll bald einhundertundachtzigtausend Florin betragen haben. Cosimo de' Medici hatte von seinem Vater auch die nahezu fanatische Neigung zu den Künsten geerbt. Er kannte sich im Lateinischen, Griechischen und Arabischen aus. Seine umfassende Bildung hatte es ihm bereits im Alter von sechsundzwanzig Jahren ermöglicht, Johannes XXIII. zum Konzil nach Konstanz zu begleiten. Vater des Vaterlandes Als Cosimo die Führung der Familienunternehmungen erhielt, war die wichtigste Sparte des Medici-Handels der Orientimport von kleinen Gütern mit hohem Wert, also von Gewürzen, seltenen Nüssen, Aloe und ähnlichem. Cosimo war aber nicht nur Kaufmann, Handelsherr, Bankier und Mäzen, er war auch Politiker; denn ein kapitalschwerer Wirtschaftskapitän mußte es damals wohl oder übel sein. Er gehörte zum Kriegsrat der zehn Gerichtsherren von Florenz. Ihm war der zweifelhafte Sieg der Florentiner über Lucca zu verdanken; er hatte diesen Krieg, der 1429 begonnen worden war, nicht gewünscht, ihn dann aber durch ein großes Darlehen finanziert und insofern überhaupt erst ermöglicht. Im Jahr 1433 versuchte Rinaldo degli Albizzi, das Familienhaupt der schärfsten Medici-Rivalen, Cosimo auszuschalten, da dieser den Auftrag gegeben hatte, einen neuen riesigen Palast zu bauen. Albizzi, der auch Führer der oligarchischen Junta war, verklagte ihn; er behauptete, Cosimo wolle sich von dort aus »über seine Nachbarn erheben und sie zu Sklaven machen«, also die Republik stürzen und eine Diktatur errichten. Die Familie wurde verhaftet, und Cosimo sollte vergiftet werden, wie eine weder bestätigte noch widerlegte Legende erzählt. Cosimo aber lehnte drei, vier Tage lang jedes Essen ab und bestach den Gonfaloniere. Dadurch kam er einem Schauprozeß samt dem wohl sicheren Todesurteil zuvor. Doch er wurde mit seinen Söhnen und den wichtigsten seiner Parteigänger aus Florenz verbannt. Nun bestimmten die Albizzi unangefochten die florentinische Politik. Zwei Kriege wurden geführt, beide gingen verloren. Auf diese Weise verspielten die Albizzi alle Sympathien. Rinaldo degli Albizzi wollte sich damit nicht abfinden, er war entschlossen, notfalls einen Bürgerkrieg zu riskieren. Aber der Papst, Eugen IV., vermittelte; die Waffen brauchten nicht gezogen zu werden. 1434, ein Jahr nach der für zehn Jahre ausgesprochenen Verbannung, wechselte die Signoria vom Crucifige zum Hosianna; denn die drohende Verlagerung der Medici-Geschäfte aus der Stadt öffnete Florenz alle Aussichten auf eine Finanzkatastrophe. Am 6. Oktober 1434 kehrte Cosimo zurück, begrüßt von einer jubelnden Bevölkerung. Machiavelli notierte: »Einer, der vom Sieg zurückkehrt, wird selten von einer solchen Volksmenge und mit so großer Zuneigung begrüßt wie Cosimo, der aus der Verbannung kam! Jeder rief ihm zu: > Wohltäter des Vaterlandes! < Jetzt war ihm der von den Humanisten vorgeschlagene alte Ehrentitel >Pater Patriae< sicher. « Die Rufe »Wohltäter des Vaterlandes« waren keine gewöhnlichen Schmeicheleien. Giovanni di Bicci hatte seinem Sohn Cosimo folgende Ratschläge hinterlassen: »Nichts in der Welt macht mich im Tode so vergnügt wie die Erinnerung, nie jemanden beleidigt, sondern nach Vermögen jedem wohlgetan zu haben. Ich mahne euch, dies ebenso zu tun. Was der Mensch sich nimmt, nicht was ihm gegeben wird, macht ihn verhaßt. Tut nichts gegen die deutliche Strömung, die unmißverständliche Neigung des Volkes, stellt aber seinem Unverstand nicht besseres Wissen, sondern die begütigende Rede entgegen. Laßt euch nicht mit geschäftiger Betriebsamkeit im Palast der Regierung erblicken, sondern wartet, bis man euch ruft. Greift nicht in Streitigkeiten ein; denn wer Gerechtigkeit hemmt, kommt durch Gerechtigkeit um. Wirket dahin, das Volk in Frieden und die Stadt wohlversorgt zu erhalten. « Cosimo hat sich daran gehalten, an den trüben Realismus genauso wie an den plakativen Moralismus. Die Medici sind wohl die einzige großkapitalistische Familie, die absolut demokratisch orientiert war. Der Bankier Cosimo schlug jede weithin sichtbare politische Position aus, wollte lediglich die Führung der auswärtigen Angelegenheiten in einer halboffiziellen Form akzeptieren. Er erläuterte seine Abneigung gegen Posten mit ironischer Naivität: »Sich zu einem Amt wählen zu lassen ist oft schädlich für den Körper und nachteilig für die Seele. « Dagegen charakterisierte Vespasiano Bisticci, ein scharfäugiger Kommentator und Vertrauter der Medici, als Prinzip von Cosimos Politik, sich so zu verhalten, »als ginge die Sache von anderen aus, nicht von ihm, um die Eifersucht von sich abzulenken«. Cosimo de' Medici war seine eigene Graue Eminenz. Wie sein Vater blieb er dem Anschein nach ein Bürger wie jeder andere, als Kaufmann nur darauf bedacht, den Wohlstand der Stadt Florenz und seiner Bewohner zu fördern. Die Medici besaßen in Florenz zwei Tuchbetriebe. Neben dem Textilgewerbe konzentrierte Cosimo sich auf das Alaungeschäft, das sein Vater in Gang gebracht hatte. Ein Jahrzehnt genügte, um das Monopol auf die florentinische Alauneinfuhr zu sichern. 1433 gehörten den Medici zweiundfünfzig Handelshäuser in Europa und sechzehn Filialen. 1440 zog Florenz dank der Aktivität Cosimos im Levantehandel mit Pisa und Venedig gleich. Es erreichte den Höhepunkt in seiner Rolle als Finanzkapitale Europas: Hier, am Arno, wurden die Kurse aller europäischen Geldsorten festgelegt, bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Schon 1437 hatte Cosimo damit begonnen, die Kurie zu finanzieren. Papst Eugen IV. überließ ihm gegen eine Hypothek von fünfundzwanzigtausend Gulden die Burg Assisi. Ohne die mediceischen Subventionen hätte damals kaum ein Konzil durchgeführt werden können. Cosimo schoß für diesen Zweck vierunddreißigtausend Gulden vor. Die längste Zeit in der Geschichte war es eine Regel, daß Ruhm und Glanz einer Stadt, eines Landes, einer ganzen Epoche vom Stand der Wissenschaften und von der Förderung der Künste abhingen. Cosimo de' Medici hat diesem Prinzip oberste Richtwerte gegeben. Er schickte Agenten und Gelehrte fast reihenweise nach Griechenland, Konstantinopel, in jede Ecke Europas, in der man Manuskripte vermutete, die vielleicht sogar zu kaufen waren. 1444 gründete er die erste öffentliche Bibliothek Europas, die Medicea, heute als Biblioteca Laurenziana bekannt. Im einzelnen läßt sich nicht aufzählen, wie viele Werke antiker Schriftsteller ohne die Bibliomanie dieses Medici verlorengegangen wären. Der Florentiner Niccolò de’ Niccoli aus dem Freundeskreis Cosimos gab sein Vermögen bis zum letzten Gulden für Bücher und Manuskripte aus. Als er nichts mehr besaß, übernahm Cosimo seine Auslagen in unbegrenzter Höhe. In der Medicea, die für Europa etwas ganz Einmaliges darstellte, befindet sich das juristische Sammelwerk Justinians, die >Pandekten<, die Grundlage des römischen Rechts. Cosimo trug Abschriften nach Äschylus, Sophokles, Vergil oder Plinius zusammen und erlaubte jedem, der sie lesen wollte, die Ausleihe — so vertrauensselig war er in diesen Dingen. Cosimo hatte viel Vergnügen daran, mit den klügsten Bürgern das Gelesene zu diskutieren. Manuskripte, die er nicht erwerben konnte, ließ er abschreiben. Er beschäftigte fünfundvierzig Schreiber, die ausschließlich Kopien alter Werke anfertigten. Was in Cosimos Zeit für die Kunst getan wurde, ist ein eigenes Kapitel der Kunstgeschichte. Einige Namen müssen genügen: Michelozzo di Bartolomeo, Fra Angelico, Filippo Lippi, Benezzo Gozzoli, Filippo Brunelleschi, Lorenzo Ghiberti, Donatello. Der berühmte Bronze – David Donatellos wurde wahrscheinlich in den Jahren 1430 bis 1433 geschaffen. Er ist seit der Antike, seit vielen Jahrhunderten, die erste freistehende nackte Plastik des Abendlandes, eine ebenso gewagte wie revolutionäre Leistung. Es ist bezeugt, daß er von 1469 an - vermutlich schon vordem - im Hof des Medici-Palastes stand und 1495 in den Palazzo Vecchio gelangte; heute ist er im Bargello – Museum zu sehen. Florenz als Gemeinwesen war damals ein Phänomen eigener Art. Der Verfassung und dem Äußeren nach gab es keinen anderen Stadt-Staat, der so offensichtlich eine demokratische Republik war. Und doch wurde Florenz nicht anders regiert, als führte ein Despot die Geschäfte; denn hier setzte ein einzelner seine Intentionen ohne Zugeständnisse durch: Cosimo, ohne daß er die demokratischen Formen verletzte. Der republikanische Geist von Florenz störte sich nicht an dem Unterschied zwischen Armen und Reichen, weil auch der Minderbegüterte potentiell ein Wohlhabender war. Beide fühlten sich in erster Linie als Bürger. Unüberbrückbar dagegen war der Abstand zwischen Aristokratie und Bürgertum. Papst Pius II. bescheinigte Cosimo: »Ihr seid ein König in jeder Beziehung, außer dem Namen nach. « So konnte man es auch sehen. Aber in Florenz war kein König denkbar, den man mit Öl gesalbt hatte, viel eher ein König der Großfinanz, der mit allen Wassern gewaschen war, sei es kaufmännisch, politisch oder auf dem Gebiet diplomatischer Dezenz. Am deutlichsten schrieb es Machiavelli: »Die Medici waren von ihren Mitbürgern aufgezogen und genährt worden und beherrschten sie ihrerseits auf so familiäre Art, daß jene sich geehrt fühlten. « In der Außenpolitik sind Cosimo zwei entscheidende Dinge gelungen. Erstens: Er achtete zwar auf das Image, daß Florenz eine Demokratie sei, war sich aber darüber im klaren, daß er den Staat nicht anders dirigierte als die vielen Alleinherrscher in den großen, kleinen und winzigen Städten Italiens und daß er wie sie alle jederzeit von einer Opposition oder einem Opponenten gestürzt werden konnte. Er war auf Frieden und Ruhe bedacht, zielte deshalb nicht auf irgendwelche Rechtsgrundsätze oder politische Prinzipien und ihre Verwirklichung ab, sondern darauf, ein Gleichgewicht unter den Herrschenden in Italien zu erhalten. Er brachte es beinahe zu einer stillschweigenden Vereinbarung, daß man sich um der Herrschaftsfestigkeit willen gegenseitig stützen und absichern mußte. Der Effekt war eine lange Phase labiler Stabilitätspolitik, von der fast jedes Gebiet Italiens profitierte. Zweitens: Cosimo ist es gelungen, Florenz zu einem ruhenden Pol im Kreis der Hauptmächte Italiens zu machen und die Spannungen der Staaten untereinander auf ein Minimum zu reduzieren. Auch hier also ein Gleichgewichtskonzept mit dem Erfolg, daß jeder Staat sich ohne Kriege der Wirtschaft und prosperierender Solidität widmen konnte. Mit Francesco I. Sforza und Mailand verband Cosimo eine unbedingte Freundschaft, sein Verhältnis zu Venedig und Neapel konnte er gut temperieren, und als 1452 seine Politik diesen Mächten gegenüber zu scheitern drohte, führte die Eroberung Konstantinopels im Frühling 1453 rasch zu einer Solidaritätsübereinkunft, die im Frieden von Lodi zum verbindlichen Buchstaben wurde. Ausschlaggebend wie die überlegene Diplomatie Cosimos war selbstverständlich das ungeheure Kapital, das er einsetzen konnte. Heute ist es im einzelnen kaum noch zu klären, wie viele Herrscher von der mediceischen Bank unterstützt wurden. Fest steht nur, daß kaum jemals die Kombination von Kapital und Klugheit außerhalb der traditionellen königlichen Legitimität größere Regierungserfolge verbucht hat als unter den Medici. Allerdings muß gerade bei Cosimo und seiner geschulten Bescheidenheit unterstrichen werden, wie stark auch er sich der üblichen politischen Mittel der Zeit bediente. Wenn er zum Ausdruck brachte, daß »ein Staat nicht mit Paternostern regiert« werde, so erinnert das an eine Formulierung, wie sie wenig später Caterina Sforza verwendet hat. Das ging bis zur heimlichen Beseitigung von Leuten, die zufällig oder unglückseligerweise seinen politischen Plänen gefährlich waren; aber selbst diese Geschäfte besorgte er niemals direkt. Er schickte ergebene Räte nach vorn, die mit Aufwieglern Fraktur sprachen. Bei Steuerhinterziehungen war er mehr als großzügig, mit dem feinen Haken, daß er die Beweise dafür sorgfältig sekretierte und dadurch alle Eventual – Intrigen von vornherein unmöglich machte. Gleichfalls vollendet beherrschte er die charakteristischen Methoden monetärer Kreise, um mit hartnäckigen Gegnern fertig zu werden. Die vom Vater übernommene Abgabenreform verbesserte er, aber auch zu seinen politischen Gunsten. Cosimos Anwendung der Decima scalata, einer progressiven und in Zweifelsfallen freizügig zu handhabenden Einkommenssteuer, konnte zur sicheren finanziellen Vernichtung des Betroffenen führen. Gianozzo Manetti, der große Humanist, war eins dieser Opfer: 1453 mußte er Florenz verlassen; er ging nach Rom und dann nach Neapel. - Cosimos eigener Reichtum war nicht nur von selbst gewachsen. Über die Unsauberkeit vieler Gewinne und Geschäfte wußte Cosimo recht gut Bescheid; denn er hielt nichts von Schuldscheinheiligkeit. Als er Papst Eugen IV. seine Skrupel klagte, bekam er von diesem schnell Rat: Er solle »zur Beruhigung und Erleichterung seines Gemüts zehntausend Florinen« für ein Kloster stiften. Da der Medici über das Ausmaß seiner unsoliden Profite besser orientiert war als der Papst, stiftete er das Vierfache. Kurz vor seinem Tod betrug sein Vermögen zweihundert-siebzigtausend Goldgulden. - Im Jahr 1458 mußte Cosimo durch eine Art kaschierten Staatsstreich noch einmal seine politischen Gegner ausschalten. Insgesamt aber war seine lange Regierungszeit verhältnismäßig ruhig. Er starb am 1. August 1464. Figlio del Sole Nach dem Tod seines Sohnes Piero, der Florenz fünf Jahre geleitet hatte, übernahm 1469 Cosimos Enkel, Lorenzo I. de' Medici, die Führung der Staatsgeschäfte. Auch wenn seine Stellung als Privatmann und einfacher Bürger nach außen hin aufrechterhalten wurde, gibt es keinen Zweifel daran, daß mit dieser Wahl auf Vorschlag der angesehensten Familien von Florenz die Erbfolge der Medici eine Art von Legitimität erhielt. Lorenzo I. de' Medici war damals erst zwanzig Jahre alt. Die Überlegung, ihn an die Spitze von Florenz zu stellen, ließ sich nur verwirklichen, weil niemand das Risiko eingehen wollte, einer anderen Familie den Vorzug zu geben und damit die tatsächliche Macht und das hohe Ansehen der Medici zu ignorieren. Lorenzo war sich darüber im klaren, daß hier nichts Normales im Sinne einer Thronfolge geschah. Er hatte wie sein Großvater tröstende Ironie zur Hand. In seinen >Erinnerungen< meinte er, solch eine Position hätte seinem Alter noch nicht entsprochen und wäre mit viel Mühen und Gefahr verbunden; seine Zustimmung sei ohne Vergnügen gegeben worden und nur »um die Freunde und unser Vermögen zu erhalten; denn in Florenz kann man schlecht leben ohne den Staat«. - Cosimo hatte man geachtet und verehrt. Lorenzo dagegen wurde von Florenz geliebt. Nicht wegen seiner Jugend und schon gar nicht wegen seines Äußeren: Die Medici-Köpfe sind berühmt wegen ihrer komplexen Häßlichkeit, speziell Lorenzos eindrucksvoll abstoßendes Profil, dessen imperatorische Verzerrung jede physiognomische Deutung in Widersinnigkeiten führt. Lorenzo wurde wegen seiner Unbeschwertheit geliebt, wegen seiner offenen Haltung, seiner Anmut und Fröhlichkeit. Diese Eigenschaften waren deshalb so bezwingend, weil ihnen essentielle Momente von Trauer und Melancholie zugehörten, zwei Ingredienzen der Menschlichkeit, die Lorenzos ganzes Leben durchsetzten. Er leitete die Stadt nicht viel anders als seine Vorgänger, nur weniger verborgen; er nahm die Sichtbarkeit als Odium und Schicksal in Kauf. Er gab die einfache Bürgerrolle auf, benahm sich als Fürst, allerdings nicht in Pomp und Prunk, sondern in Anspruch und Aplomb. Auch das nahm ihm Florenz ab; denn seine Sicherheit war eminent natürlich, ostensibel heiter. Neun Jahre regierte Lorenzo I. de' Medici ohne ernsthafte Schwierigkeiten und Verwicklungen. Von den früheren Medici unterschied er sich besonders auffällig dadurch, daß er über der Intensität seiner politischen Arbeit niemals vergaß, bei allen Gelegenheiten die großartigsten Feste zu feiern. Der verschwenderische Aufwand für solche Veranstaltungen war vom Geist Ferraras erfüllt, im eigenen Haushalt jedoch war Lorenzo mehr als genügsam. Er inszenierte keine Familienbankette, keine Feiern in ausgewähltem Freundeskreis, sondern öffentliche Festlichkeiten, an denen sich ganz Florenz beteiligte: Turniere, Fackelzüge, Maskenfeste, Feuerwerke, Umzüge, Konzerte und Tanzvergnügungen. Der Wille zur affirmativen Feier, zur Selbstdarstellung in kommunikativer Lustbarkeit und öffentlicher Freude ist signifikant für dieses Jahrhundert. Doch was in Ferrara noch ohne Sprünge gewesen ist, war unter symptomatischem Gesichtspunkt im Florenz Lorenzos zwar schon jenseits der Stellvertretung, hat sich aber hier zu einer Pracht entfaltet, deren Funkeln bereits von sublimer Korruption durchschossen wurde. Diese Endgültigkeit klingt durch das entschlossene Wort Lorenzo de' Medicis: »Facciamo festa tuttavia! « Machiavelli notierte in einem Augenblick analytischer Schwäche, Lorenzo de' Medici habe »sich das Herz des Volkes durch freizügiges Denken und andere populäre Eigenschaften« gewonnen. Aber intellektuelle Liberalität ist wohl das letzte, das als volkstümlich bezeichnet werden kann. Sie träfe weit mehr auf einen so dogmatisch-besessenen Mann wie Girolamo Savonarola zu - dem reinen Gegentyp Lorenzo il Magnificos -, der einige Monate so »volkstümlich« wurde, wie es der Medici niemals war. Die bewundernde Liebe, die man Lorenzo entgegenbrachte, basierte auch nicht auf dem satten Empfinden, daß die Schulter, die man klopft, nicht höher ist als die eigene. Bestechend an Lorenzo de' Medici war die Wechseleinheit von Kraft und Beherrschung, von Leidenschaft und Reserve. Sollte in der Epochenbezeichnung das Daseinsverhältnis und die Lebenswirklichkeit integriert sein, dann hat die Hochrenaissance in Lorenzo il Magnifico Gestalt erhalten. Aber selbst verblüffende Modernität wird durch ihn sichtbar: Die kluge Desillusioniertheit des selbstbewußten Menschen, der keine Angst vor seiner gläubigen Vitalität und seinem vitalen Glauben gekannt hat. Wenn er allein war, sang er oft so inbrünstig zur Laute, als wäre er »von göttlicher Raserei entflammt«. So erlebte es Marsilio Ficino, der berühmte Philosoph, ein Freund Lorenzos. Unerschöpflich war für den Medici das Thema der Liebe, sicherlich nicht nur wegen einer Abhängigkeit von den Lineamenten Platons. Seine Bemerkung, daß jeder Liebende einer »forte imaginazione« unterworfen sei, war auch nicht platonisch, sondern als Selbstausweis zu verstehen. Sein Leben lang habe er glühend geliebt - nicht seine Frau Clarice Orsini. Die Namen seiner Geliebten sind kaum bekannt, doch es sind nicht viele gewesen, da Lorenzo zu kraftvoll war, um flüchtig zu sein. Dazu paßt seine betonte Diskretion; er hielt nichts davon, andere samt dem üblichen Gerede an dem zu beteiligen, was ihn am stärksten berührte.
In der Öffentlichkeit bewegte er sich mit Würde und freundlichem Ernst. Standesunterschiede wurden von ihm ignoriert. Sein scharfer Geist war gefürchtet, auch sein treffender Witz. Ein Diplomat über seine Ausstrahlung: »Bevor er mit dem Mund zu sprechen beginnt, sprechen seine Augen« — eine Variante der altitalienischen Spruchweisheit, daß die Toskaner den Himmel in den Augen und die Hölle im Mund haben. Angelo Poliziano bestätigte: »Scharf ist seine Rede und gewichtig und wenn nötig mit Salz gewürzt, aber mit dem Salz aus jenem Meer, dem die Venus entstiegen ist. « Machiavelli, dessen Maßstäbe schon stark vom Manierismus leben, beanstandete an Lorenzo die Natürlichkeit im Privaten; daß er mit seinen Töchtern und Söhnen gespielt hat, als wäre er selbst ein Kind, erschien Machiavelli als »unschicklich für einen solchen Mann«. Stichhaltiger ist seine Feststellung, Lorenzo sei der größte Schirmherr der schönen Künste gewesen, den es jemals gegeben habe. Im Zentrum seines Mäzenatentums stand die Dichtung, diejenige Kunst, die ursprünglich dem fördernden Gönnertum zu seinem klassischen Namen verholfen hatte und die für Lorenzo il Magnifico ebenfalls eine höchst persönliche Rolle spielte. Ihm selbst ist keine große Dichtung gelungen, aber er war dieser Kunst restlos verfallen. Er glaubte unerschütterlich daran, daß nicht nur die eigene Dichtung - auch innerhalb ihrer Grenzen — seinen Ruhm sichern würde, sondern daß seinem Mäzenatentum später dieselbe Bedeutung zugebilligt werden müsse. Zu Lorenzo il Magnifico gehört der welthistorische Ruhm der Platonischen Akademie, gehören die Freundschaften mit Marsilio Ficino, Luigi Pulci, Angelo Poliziano und Pico della Mirandola. Von Ficino war Lorenzo mit den Schriften Platons vertraut gemacht worden. Platonisch in unverfälschtem Sinn versuchte er sein Leben zu führen. Er bemühte sich darum, daß Florenz sich nicht nur ruhmrednerisch dem Athen des Perikles zur Seite stellte, sondern auch den Werken nach; das aber sowohl zum Ruhm der Stadt als um seines eigenen Namens willen. Neben der Dichtung forderte Lorenzo besonders die Architektur und die Malerei: Verrocchio, Domenico Ghirlandaio, Botticelli, Luca Signorelli, Benozzo Gozzoli, Filippino Lippi, Cosimo Rosselli. Nur die Beziehung zu dem jungen Leonardo da Vinci war nicht so, wie es viele Kunsthistoriker vierhundert Jahre später gern gesehen hätten. Allerdings gab es für den Medici genügend Grund zur Zurückhaltung: Im Jahr 1478 hatte Leonardo einen Auftrag der Stadt angenommen, dann aber nichts weiter getan, als den Vorschuß kassiert. Drei Jahre später hatte er sich unter ähnlichen Umständen zur Fertigstellung eines großen Altarbildes, der Anbetung der Könige<, verpflichtet, jedoch nach einigen Studien die Arbeit eingestellt. Verständlich, daß Lorenzo den Künstler 1482 leichten Herzens nach Mailand zu Lodovico il Moro gehen ließ. Andererseits ist es ausschließlich dem Medici zu verdanken, daß der fünfzehnjährige Michelangelo seinen Weg zur Kunst fand. Man hat nicht umsonst gesagt, Lorenzo könne die Bedeutung von Künstlern und Gelehrten wittern, »wie das Wild auf der Jagd«. Ob es Zweck-Elogen waren oder nicht - schon die Zeitgenossen haben ihn als geistigen Vater der Größten in Malerei und bildender Kunst dieser Epoche gerühmt. Lorenzo il Magnifico versuchte einmal nachzurechnen, was die Familie seit seinem Großvater für die Künste finanziell getan hatte. Dabei wußte er, daß eine solche Bilanz nur Spielwert besaß, weil die Äquivalenzen nicht zusammenpassen. Außerdem bedauerte er seine eigene Unzuständigkeit im Kaufmännisch-Finanziellen. Unter seiner Ägide wurden die Handels- und Bankgeschäfte der Familie rückläufig. Das lag größtenteils an der allgemeinen wirtschaftlichen Situation in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, aber viel auch an Lorenzos Gleichgültigkeit. Er mußte wichtige Niederlassungen im Ausland schließen. Seine Bankverwalter in Florenz waren genötigt, ein Stützungsdarlehen der Stadt aufzunehmen. Trotz solcher mediceischen Depressionen gilt die Ära Lorenzos mit Recht als Höhepunkt der Familiengeschichte und der ganzen Geschichte von Florenz. Die Pazzi – Verschwörung Im Jahr 1471 wurde in Rom Sixtus IV. zum Papst gewählt. Gerade bei ihm ist das Wort >gewählt< schlecht gewählt, da kein anderer Papst, nicht einmal Alexander VI., sich das Amt so skrupellos gekauft hat wie Sixtus. Der Papst, dessen Denken ausschließlich um Geld und Macht kreiste, registrierte rasch die schwierige Situation der Medici-Bank; sie war für ihn das Signal, sich auch in die florentinische Politik einzumischen, zu versuchen, Florenz in Abhängigkeit zu bringen. … „ Das eingefügte Bild zeigt: Lorenzo I. de' Medici zwischen Antonio Pucci und Francesco Sassetti mit seinem Sohn Aus dem Wandgemälde >Bestätigung des Franziskanerordens< von Domenico Ghirlandaio in S. Trinità in Florenz, 1483 . Geschichte der Deutschen S. 154 – 163 „Auf der Grundlage dieses Paktes begannen Hitlers diplomatische Konsolidierungsbemühungen. Besonders unangenehm waren die ergebnislosen Versuche, die französische Regierung in Vichy aktiv in das Bündnis einzubeziehen; der Mißerfolg war einer Reihe grober Überheblichkeitsfehler der deutschen Führung nach Abschluß des Waffenstillstandes zuzuschreiben. Auch das Spanien Francos lehnte einen Beitritt ab, ja der Caudillo verweigerte hartnäckig einen Durchmarsch deutscher Truppen zur Eroberung Gibraltars. Hitler legte deshalb die Pläne für das Unternehmen Felix< Anfang Januar 1941 unwiderruflich beiseite. Weit wichtiger als das Werben um Paris und Madrid waren die Bemühungen Hitlers, das Verhältnis zu Moskau im Sinne der umfassenden Kontinental-Allianz auszubauen. Einschneidend dabei wurde der Besuch Außenminister Molotows in Berlin und seine langen Gespräche mit Hitler am 12. und 13. November 1940. Diese Beratungen lösten die wichtigste Entscheidung aus, die Hitler während des Zweiten Weltkrieges gefällt hat. Für die Sowjetunion hatte sich die bisherige Form der Verbindung mit Deutschland als äußerst ertragreich erwiesen; das bezog sich nicht nur auf die Besetzung Ostpolens. Hitler hatte in den vorangegangenen Monaten eine ganze Reihe zusätzlicher sowjetischer Maßnahmen studieren können, deren Zielsicherheit klare Rückschlüsse auf die russischen Vorstellungen von den Bedingungen und Grenzen der eigenen Interessensphäre zuließen. Die sowjetische Ausdehnung nach Polen war von ihm selbst in den Verträgen mit Stalin gebilligt worden. Im September und Oktober 1939 hatte Moskau in ultimativer Form Estland, Lettland und Litauen veranlaßt, wichtige Land-, See- und Luftstützpunkte der Roten Armee zu überlassen. Von Finnland hatte sich Moskau während des Winterfeldzuges 1939/40 schon einen wichtigen Zugang zur Ostsee erkämpft. Am 12. Juni 1940 hatten sowjetische Truppen Litauen besetzt und vier Tage später waren sie auch in Estland und Lettland einmarschiert. Die baltischen Anliegerstaaten waren damit ausgelöscht. Am 26. Juni hatte Moskau an Rumänien ein Ultimatum gerichtet, daß Bessarabien und die Nordbukowina an die Sowjetunion abzutreten seien. Die Regierung in Bukarest hatte nachgegeben und gegen die Besetzung dieser Gebiete keinen Widerstand geleistet. Einen Monat später hatte sich die Lage im Südosten erneut krisenhaft zugespitzt: Die ungarisch-rumänischen Verhandlungen über eine Lösung der Siebenbürgen-Frage - ebenfalls ein Erbe des Ersten Weltkrieges, da im Gefolge des Zusammenbruchs der Mittelmächte eine starke magyarische Minderheit unter rumänische Herrschaft gekommen war - hatten sich festgelaufen. Rumäniens deutschfreundliche Regierung hatte daraufhin Berlin um einen Schiedsspruch gebeten. Hitler, dazu bereit, hatte sogleich angeordnet, alles militärisch Notwendige für eine Besetzung der rumänischen Ölfelder vorzubereiten. Zehn deutsche Divisionen wurden zusätzlich nach Südostpolen verlegt. Gleichzeitig trafen zuverlässige Meldungen von größeren sowjetischen Truppenbewegungen an der sowjetisch-rumänischen Grenze ein. Am 30. August 1940 regelten Deutschland und Italien gemeinsam den Streit zwischen Budapest und Bukarest. Ungarn erhielt das Nordgebiet von Siebenbürgen und den Szekler-Zipfel am Rand der Ostkarpaten. Berlin und Rom garantierten die neuen rumänischen Grenzen. Moskau wurde bei diesen Verhandlungen nicht konsultiert. Am z. September brach eine deutsche Militärmission nach Rumänien auf. Ihr ausführlicher Bericht über die Lage in Rumänien veranlaßte Hitler, Anfang Oktober eine Infanteriedivision nach Bukarest zu schicken, teils zum Schutz des Ölgebiets, teils zur Ausbildung von drei rumänischen Musterdivisionen. Die Chefs der deutschen Militärmission trafen am 12. Oktober in Rumänien ein. Einen Tag später ließ Hitler durch einen Brief Ribbentrops an Stalin den sowjetischen Außenminister zu einem Besuch nach Berlin einladen. Das erste Gespräch zwischen Hitler und Molotow fand am Nachmittag des 12. November statt. Zum Auftakt unterstrich Hitler energisch die Gemeinsamkeit der Interessen beider Staaten. Zwischen Rußland und Deutschland müßten keinerlei Gegensätze bestehen und sollten sich auch in Zukunft nicht entwickeln, wenn beide Nationen begriffen, daß jede von ihnen auf gewisse Lebensnotwendigkeiten unbedingten Anspruch habe. Die augenblickliche Situation beider Staaten unterscheide sich vor allem darin, daß Deutschland Krieg führe, die Sowjetunion dagegen nicht. Viele Maßnahmen, die Deutschland ergriffen habe, seien durch die Tatsache seiner Kriegführung beeinflußt worden. Viele Schritte, die im Lauf des Krieges notwendig geworden seien, hätten sich aus der Kriegführung selbst entwickelt und seien deshalb bei Kriegsausbruch noch nicht vorherzusehen gewesen. Molotow stimmte dem lebhaft zu. Hitler schränkte ein, daß vielleicht nicht jedes der beiden Völker seine Wünsche ganz und gar erfüllt bekommen habe. Doch sei im politischen Leben eine zwanzig- oder fünfundzwanzigprozentige Realisierung von Forderungen schon sehr viel wert: »Ich glaube, daß auch in Zukunft nicht jeder Wunschtraum in Erfüllung gehen wird, daß aber die beiden größten Völker Europas, wenn sie miteinander gehen, auf jeden Fall größeren Gewinn haben werden, als wenn sie gegeneinander arbeiten. « Auch dazu nickte Molotow beifällig. Dann wurde Hitler präziser: Deutschland sei durch die ungeheure Ausweitung des Krieges dazu gezwungen worden, in Gebiete vorzudringen, an denen es politisch und wirtschaftlich nicht im mindesten interessiert sei. Es handle sich in allen diesen Fällen um Expansionen rein militärischen Charakters und aufgrund militärischer Zwangslagen. Die Probleme, die dadurch entstanden seien, würden nur existieren, solange der Krieg andauere. In keinem Fall aber würden in irgendeiner Form die Interessen Rußlands berührt. Das gelte speziell für den Balkan, auf dem Deutschland überhaupt keine politischen Ambitionen habe; es sei dort im Moment lediglich aktiv, weil es sich bestimmte kriegswichtige Rohstoffe sichern müsse. Dies alles sei belanglos im Vergleich mit dem Hauptproblem der ferneren Zukunft, und dies bestehe darin, gegenüber den USA eine Solidarität zwischen denjenigen Staaten herzustellen, die bei einer Ausweitung des amerikanischen Einflußbereiches in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Das Datum dafür stehe noch nicht dicht bevor, es handle sich also nicht um das Jahr 1945 - wie Hitler ausdrücklich erwähnte -, sondern frühestens um die Jahre 1970 oder 1980. Allerdings müsse sich der europäische Kontinent bereits auf diese Entwicklung einstellen. Daraus ergebe sich die Notwendigkeit einer großen Kombination von Mächten, die unter völlig nüchterner Beurteilung der Realitäten ihre Interessengebiete untereinander festlegen müßten, damit sie sich dann der anderen Welt gegenüber unter den entsprechenden Bedingungen erfolgreich behaupten könnten. Sicherlich sei es eine schwere Aufgabe, eine derartige Kombination von Staaten zustande zu bringen; insofern gehe es zum Augenblick nur um eine gedankliche Regelung. Molotow hörte betont aufmerksam zu, bog aber in seiner Erwiderung von den großen Perspektiven sofort ab, indem er die sowjetische Sicht an den Forderungen entwickelte, die in den jüngsten Gebietserwerbungen Rußlands augenfällig geworden waren. Rußland habe viel erreicht, doch die Interessen Moskaus gingen in Finnland und auf dem Balkan über den augenblicklichen Stand hinaus. Die deutsch-russischen Beziehungen benötigten tatsächlich eine dauerhafte Grundlage, aber Deutschland - daran ließ Molotow nicht den Schatten eines Zweifels — könnte in Zukunft nur dann mit dem unveränderten Wohlwollen Sowjetrußlands rechnen, wenn es sich damit einverstanden erklärte, daß ganz Rumänien und Bulgarien in die sowjetische Sicherheits- und Interessensphäre einbezogen würden und damit die Voraussetzung dafür geschaffen würde, das klassische Notproblem Moskaus aus der Zarenzeit zu erledigen: Rußland sei die größte und bedeutendste Macht am Schwarzen Meer; deshalb müsse sein freier Zugang zum Mittelmeer durch Bosporus und Dardanellen mit Hilfe sowjetischer Stützpunkte auf türkischem Gebiet gesichert werden. Das bildete den Kern der ersten Entwicklungsphase, wie sie Molotow skizzierte. Die zweite Phase der sowjetischen Perspektive, deren Verwirklichung sich dem deutschen Konzept der territorial-staatlichen Neuordnung sowohl zur Seite stellte, als auch dasselbe modifizierte und vor allem die Bedingung für seine Realisierung war, erstreckte sich auf andere Fernziele. Molotow umriß sie im Detail erst am Abend des 13. November in einem Gespräch mit dem deutschen Außenminister. Rußland sei elementar interessiert an allen künftigen Neuordnungen und -gestaltungen in Europa, besonderen Anteil nehme es am Schicksal Rumäniens und Ungarns, Jugoslawiens und Griechenlands. Der sowjetische Außenminister erinnerte Ribbentrop eigens daran, daß ein Protokoll zwischen der Sowjetunion und Deutschland existiere; dort sei ein Meinungsaustausch zwischen beiden Mächten als notwendig vereinbart worden, bevor eine verbindliche Neugestaltung Polens verwirklicht würde. Die Westgrenze Rußlands, wie sie im November 1940 festgelegt war, betrachtete Moskau also keineswegs als endgültig, es schloß vielmehr Westpolen in seine Interessensphäre mit ein. Selbst Schwedens Neutralität schätzte Molotow nicht als ein Problem ein, das beide Staaten ernstlich bekümmern müßte. Diesen Aufriß beendete der sowjetische Außenminister mit der Versicherung, daß Rußland künftig auch äußerstes Interesse daran habe, wie die Ausgänge der Ostsee zur Nordsee, Skagerrak und Kattegat, kontrolliert würden. Solche Ziele Moskaus waren noch niemals so deutlich ausgesprochen worden. Ribbentrops Bericht von Molotows Eröffnungen wirkte wie ein Schock. Göring schilderte die deutsche Reaktion später mit dem Satz: »Das hat uns alle vom Stuhl gerissen! « Rußland wollte erst seinen 'Wunsch erfüllt sehen, mit Deutschland die Grenzen der beiden Interessensphären neu abzustecken, bevor es Verhandlungen über seinen Beitritt zum Dreimächte-Pakt begann. Ebenso wurde der schwierigste Differenzpunkt deutlich: Molotow beharrte auf dem Recht Rußlands, einen neuen Krieg mit Finnland zu beginnen, das ganze Land zu besetzen und zu annektieren. Das aber lief Hitlers Einschätzung von der Tragweite neuer Kampfhandlungen im Ostseeraum strikt zuwider; er stimmte diesem russischen Plan unter keinen Bedingungen zu. Seine Enttäuschung und Verärgerung über das sowjetische Festbeißen an Vordergrundzielen äußerte sich wiederholt in heftiger Ironie. Als Molotow sich danach erkundigte, was denn Deutschland dazu sagen würde, wenn Rußland eine Garantie der bulgarischen Grenzen nach dem Vorbild der deutsch-italienischen Garantie Rumäniens in Sofia präsentieren würde, antwortete Hitler mit einer sarkastischen Gegenfrage: Habe denn Bulgarien um eine solche Garantie ersucht? Nur wenn das der Fall sei, bestünde eine Parallele zum rumänischen Modell. Ihm aber sei von einer derartigen Bitte Sofias nichts bekannt. Die Bilanz der Unterredungen mit Molotow am 12..und 13.November 1940 war für Hitler im Hinblick auf seine Bemühungen, eine Weltkoalition »zu schaffen, die aus Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, Sowjetrußland und Japan bestehen und eine von Nordafrika bis nach Ostasien reichende Interessengemeinschaft darstellen würde«, negativ. Ihr positiver Ertrag bestand lediglich darin, daß es jetzt keine Zweifel mehr darüber gab, welche Entscheidungen Hitler treffen mußte, wenn er den Krieg nach seinen Vorstellungen gewinnen wollte. Die Absicht der Sowjets, die russische Westgrenze nach Europa hineinzudrücken, spielte für Moskau eine zu starke Rolle, als daß es nicht in Kürze zu äußerst heiklen Konfrontationen mit Deutschlands Interessen vom Norden bis zum Mittelmeer kommen würde. Der Chef des Wehrmachtsoberkommandos Keitel behauptete, Hitler hätte nach der Abreise des sowjetischen Außenministers die Perspektiven Molotows als den » Beginn eines großen Einkreisungsmanövers um Deutschland« dargestellt. Sollte Hitler wirklich vor dem Besuch der Ansicht gewesen sein, daß man sich von den Verhandlungen nichts versprechen müsse, so traf das nicht auf die Klärung der Positionen zu. Berlin und Moskau wußten nun, woran sie waren. Einen Monat lang überdachte Hitler seine nächsten Entscheidungen. Sie wurden beschleunigt durch die offizielle Antwort Molotows auf die deutschen Vorschläge, die Ende November in Berlin eintraf. Rußland erklärte sich nur dann bereit, dem Dreimächte-Pakt beizutreten, wenn die Bedingungen erfüllt würden, die Molotow in Berlin vorgetragen hatte: Deutschland mußte den Sowjets freie Hand in Finnland lassen, einem Beistandspakt zwischen Rußland und Bulgarien zustimmen und die Errichtung militärischer Stützpunkte an den Meerengen im Gebiet des Bosporus und der Dardanellen akzeptieren, notfalls mit Gewalt. Moskau demonstrierte ganz unverhüllt, daß das augenblicklich wenig günstige Stadium in der Schlacht um England und Italiens militärische Unternehmungen für Stalin genügend Anlaß waren, seine West-Aspirationen hart an der Grenze der offenen Nötigung zu entwickeln. Hitler reagierte massiv: Er untersagte es seinem Außenminister, Molotow zu antworten. Gleichzeitig wurde Hitler über Geheimgespräche zwischen Rußland und den Vereinigten Staaten informiert. Wenn sie erfolgreich verliefen, konnte das Ergebnis nur eine Koalition Washington-Moskau-London sein. Das bestärkte Hitler in seiner Überzeugung, daß er lediglich durch einen Sieg über die Sowjetunion alle englischen Hoffnungen auf eine Niederringung Deutschlands zerstören könne. Am 5. Dezember 1940 äußerte er zu Feldmarschall von Brauchitsch: »Die Entscheidung über die europäische Hegemonie fällt im Kampf gegen Rußland. « Am 18. Dezember gab Hitler die Weisung Nr. 21 aus, bis zum 5. Mai 1941 den >Fall Barbarossa< auszuarbeiten, den Angriff auf Rußland vorzubereiten. Nach dieser Weisung sollte noch vor Beendigung des Krieges gegen Großbritannien im Verlauf eines schnellen Sommerfeldzuges Sowjetrußland niedergeworfen werden. Unwiderruflich legte sich Hitler allerdings auch jetzt noch nicht fest; er verfügte: »Alle von den Herren Oberbefehlshabern aufgrund dieser Vereinbarung zu treffenden Anordnungen müssen eindeutig dahin abgestimmt sein, daß es sich um Vorsichtsmaßnahmen handelt für den Fall, daß Rußland seine bisherige Haltung gegen uns ändern sollte.« Um England hatte sich Hitler nach Kriegsausbruch immerwiederbemüht; er hatte versucht, ein Arrangement zu finden, und sich erst spät von der Unnachgiebigkeit Londons überzeugen lassen, widerstrebend, enttäuscht, verbittert, wenngleich er derart emotional-menschlichen Empfindungen in der Regel keinen Spielraum im politischen Entscheidungsfeld ließ. Auch darauf hatte er im Gespräch mit Molotow ein Streiflicht geworfen: »Im Völkerleben läßt sich zwar die Entwicklung auf lange Zeit hinaus schwer festlegen, und oft wird das Entstehen von Konflikten stark von persönlichen Faktoren beeinflußt, trotzdem glaube ich, daß man versuchen muß, auch auf lange Sicht, soweit es geht, die Entwicklung der Nationen so festzulegen, daß wenigstens nach menschlichem Ermessen Reibungen vermieden und Konfliktstoffe ausgeschlossen werden. « Hitler hielt stets daran fest, daß sein Entschluß, die Sowjetunion anzugreifen, richtig war. Sein fanatischer Wille, den Krieg zu gewinnen und den Widerstand Englands durch Niederringung der Sowjetunion zu brechen, gleichgültig mit welchen Opfern, ist durch die weltanschauliche Feindschaft zwischen Bolschewismus und Nationalsozialismus, die Hitler jetzt nicht mehr verdecken mußte, extrem gesteigert worden. Alles, was sich mit Formeln wie »Lebensraum im Osten«, »unausweichlicher Existenzkampf gegen den Bolschewismus«, »Ausbreitung der germanischen Herrenrasse« und ähnlichen programmatischen Rastern verband, ist im Zweiten Weltkrieg weder Anlaß des Krieges noch sein bestimmendes Ziel gewesen. Bloß weil die territorial ausgreifenden Bestrebungen Stalins dem Konzept zuwiderliefen, das Hitler unter dem kontinentalen Konsolidierungszwang als unumgänglich betrachtete, mußte Rußland jetzt angegriffen werden - in einer spiegelbildlichen Wiederholung der Überzeugung Napoleons, daß gegen England nur vor den Toren Moskaus zu siegen oder zu verlieren war. Fall Barbarossa Im November 1940 war Franklin D. Roosevelt ein drittes Mal zum Präsidenten der USA gewählt worden. Wenige Tage nach diesem Triumph vertauschten die Vereinigten Staaten den Zustand der offiziellen Neutralität mit demjenigen der >Nicht-Kriegführung<. Hitler sah richtig, daß die USA das Rüsten im Laufe des kommenden Jahres abschließen und spätestens 1942 aktiv in den Krieg eintreten würden. Ob mit oder ohne zureichenden Anlaß, würde für die Politiker in Washington dann keine Gewissensfrage mehr sein. Schon jetzt verdankte es England ausschließlich der amerikanischen Hilfe, daß es gegen Deutschland durchgehalten hatte. Der materielle Versorgungsstrom über den Atlantik wuchs ununterbrochen an, mit dem Effekt, daß England trotz seiner ungünstigen Insellage im Herbst 1941 mehr Flugzeuge und Panzer produzierte als Deutschland, obwohl sich hier das Rüstungspotential inzwischen gewaltig gesteigert hatte. Die deutsche Kriegswirtschaft wurde dadurch immer stärker von russischen Rohstofflieferungen abhängig, was sich machtpolitisch für Moskau denkbar vorteilhaft auswirkte. Der deutsche Angriff im Osten verzögerte sich durch die Niederlagen, die Italien in Griechenland und in Nordafrika hinnehmen mußte. Rom hatte am 28. Oktober 1940, trotz eindringlicher Warnungen Ribbentrops, Griechenland von Albanien aus angegriffen. Hitler war konsterniert, als die Griechen den italienischen Truppen eine Schlappe nach der anderen beibrachten, sie in die Ausgangsstellungen zurückdrängten und sogar in Albanien einzumarschieren begannen. Er entschloß sich zu einer Entlastungsoffensive, nicht nur wegen der Reputation seines Bündnispartners. Politisch wollte er die Militäraktion dadurch absichern, daß die Balkanstaaten bewegen wurden, dem Dreierpakt beizutreten. Bis zum 25. März 1941 hatten sich Ungarn, die Slowakei, Rumänien, Bulgarien und Jugoslawien dem Bündnis angeschlossen. In Belgrad wurde jedoch zwei Tage später, am 27. März, gegen die Regierung geputscht. Hitler änderte sofort den Angriffsplan und gab Weisung, sowohl Jugoslawien als auch Griechenland in einer gemeinsamen Blitzaktion zu erobern. Der Termin für den >Fall Barbarossa< wurde auf den Juni verschoben. Der Feldzug gegen Jugoslawien begann am 6. April 1941. Von Bulgarien aus stieß eine deutsche Armee nach Saloniki vor; sie erreichte sechsunddreißig Stunden später ihr Ziel. Durch diese Aktion wurde die griechische Makedonien-Armee von ihren Nachschub- und Verbindungswegen abgeschnitten. Eine Panzergruppe setzte von Westbulgarien aus gegen Jugoslawien zum Angriff an. Konzentrische Aktionen begannen zur selben Zeit von der Steiermark, von Ungarn und dem Banat aus. Ungarische Verbände drangen nach Süden vor, italienische aus Istrien. Deutsche Verbände eroberten nach einer Woche Belgrad. Die Gesamtkapitulation des jugoslawischen Heeres wurde am 17. April unterschrieben. Zehn Tage später rückten erste deutsche Vorausabteilungen auch in Athen ein, und kurze Zeit später war ganz Griechenland einschließlich der Peloponnes und der Inseln besetzt. Die einzige Ausnahme bildete Kreta. Eine Eroberung dieser größten griechischen Insel war schon wegen ihres bedeutenden Flottenstützpunktes strategisch notwendig. Die Invasion wurde sorgfältig vorbereitet. Am 20. Mai begann die umfassendste deutsche Luftlandeaktion des Zweiten Weltkrieges. Kreta wurde von den Engländern äußerst zäh verteidigt. Die deutschen Verluste waren diesmal ungewöhnlich schwer. Dennoch konnte bereits nach elf Tagen das Unternehmen Merkur< erfolgreich abgeschlossen werden. In Nordafrika war die italienische Armee am 13. September 1940 von Libyen aus zu einer Offensive nach Ägypten aufgebrochen. Sidi Barrani wurde drei Tage später erobert, dann aber blieb der italienische Vormarsch östlich der Stadt wegen Nachschubschwierigkeiten stecken. Die Briten begannen mit ihrer Gegenoffensive am 9. Dezember. Ihre Nil-Armee drang bis zur großen Syrte vor, der Bucht zwischen Bengasi und Misurata. Dabei gerieten hundertdreißig-tausend Italiener in englische Gefangenschaft. Mussolini bat jetzt Berlin um Unterstützung. Hitler beorderte zunächst ein deutsches Fliegerkorps nach Sizilien, um die italienische Versorgung übers Mittelmeer zu sichern. Mitte Februar landete dann die erste Division des deutschen Afrika-Korps unter General Erwin Rommel in Libyen. Der deutsche Gegenangriff begann am 24. März. Die britischen Stellungen wurden rasch durchbrochen. Nach drei Wochen hatten die deutschen Panzer das verlorene Gebiet in Nordafrika bis zur Grenze Ägyptens zurückerobert. Nur die stark befestigte, von den Engländern heftig verteidigte Hafenstadt Tobruk in der Cyrenaica konnte während dieses Unternehmens nicht eingenommen werden. Tobruk wurde erst am 21. Juni 1942 von den Deutschen erobert. Fast volle zwei Jahre drückten Rommels Intelligenz, Phantasie, Tapferkeit und Härte den Kämpfen in Nordafrika das Gepräge auf. Er wurde zu demjenigen deutschen Heerführer, der uneingeschränkten Ruhm in legendären Dimensionen errang, sowohl bei der eigenen Truppe als auch beim Gegner, der den verwegenen >Wüstenfuchs< bewundernd verklärte; er war dem Feind vollendete Verkörperung der deutschen Dynamik und Begeisterung, aber auch deutschen Anstands und Ehrgefühls. Das bedeutete in jenen Jahren bereits so unerhört viel, daß die Schattenseiten seiner Heroengestalt kaum wahrgenommen wurden, etwa seine Versuche, die Ausbildung der Hitlerjugend straff unter den vormilitärischen Imperativ zu stellen. Rommel war 1935 Verbindungsoffizier zur Reichsjugendführung und hatte deshalb heftige Auseinandersetzungen mit Baldur von Schirach, der ihn mit dem kurzen Bescheid abfertigte: »Ich erziehe die deutsche Jugend für den Frieden, nicht für den Krieg. « Nach der Invasion der anglo-amerikanischen Truppen entdeckte Rommel die politische Dimension des Krieges und seiner eigenen Stellung. Er überwarf sich mit Hitler, schwenkte ein in den Widerstand und wurde, als der Putsch des 20. Juli 1944 fehlgeschlagen und seine Beteiligung offenkundig geworden war, von Hitler vor die Wahl gestellt, Gift zu nehmen oder sich vor einem Volksgerichtshof anklagen zu lassen. Rommel entschloß sich zum Selbstmord, am 14. Oktober 1944. Nach Abschluß der Kämpfe auf Kreta stand dem Krieg gegen Rußland militärisch nichts mehr im Weg. Hitler zog Dreiviertel aller deutschen Soldaten im Osten zusammen, mehr als drei Millionen Mann. Ihnen gegenüber standen viereinhalb Millionen Sowjetsoldaten. Gerüchte über einen bevorstehenden deutschen Angriff zirkulierten in Moskau seit April, aber Stalin und die sowjetischen Generäle hielten es für unwahrscheinlich, daß Hitler vor der erfolgreichen Beendigung des Krieges im Westen den Angriff auf Rußland riskieren würde. Stalin bereitete sich zwar durch eine gründliche Umrüstung der Roten Armee auf eine solche Auseinandersetzung vor, glaubte aber, durch diplomatische Gespräche mit Berlin über eine Neufassung der deutsch-sowjetischen Abmachungen mehr als genug Zeit zu gewinnen. Das Unternehmen Barbarossa« begann am 22. Juni 1941 und mit ihm gestaltete sich der Zweite Weltkrieg zunehmend grauenerregend. Die folgenden Etappen bis zum völligen Zusammenbruch des Deutschen Reiches waren Stationen einer Odyssee militärischer Triumphe und Katastrophen auf beiden Seiten. Das soldatische Heldentum konnte sich ein letztes Mal genauso entäußern wie erstmals ein sadistisch-systematisches Mördertum, das den wirklichen oder vorgestellten Gegner nicht mehr als militärischen Feind betrachtete, sondern weltanschaulich als Untermenschen einstufte. Dies war mitbestimmend für das Kämpfen, Töten und Morden an der Ostfront, die Partisanenkärnpfe in Jugoslawien und Rußland wie später in Italien und Frankreich, für den frühen Entschluß des britischen Kriegskabinetts, die Luftangriffe im deutschen Hinterland nicht in erster Linie wegen der Zerstörung der deutschen Rüstungsindustrie durchzuführen, sondern als Terror der Zivilbevölkerung, um sie psychisch-moralisch zu zerbrechen. Die härter werdenden Auseinandersetzungen bewirkten in Deutschland zunehmende Anstrengungen zur Mobilisierung sämtlicher verfügbaren Kräfte. Was als Notwendigkeit zur militärischen Leistungsfähigkeit selbstverständlich war - nämlich die Realisierung eines uneingeschränkten Ausnahmezustandes -, wurde später dahingehend interpretiert, daß die Diktatur des Nationalsozialismus erst jetzt ihren hemmungslos despotischen Kern und damit ihren wahren Charakter gezeigt habe. Das wurde noch dadurch intensiviert, daß die alliierten Gegner niemals einen Unterschied zwischen Nationalsozialismus und Deutschland akzeptierten, daß sie Hitler und die Deutschen miteinander identifizierten. Diese Ineinssetzung veranlaßte die Alliierten im Januar 1943, mehr als ein Jahr nach dem Eintritt Amerikas in den Krieg, zu ihrer Forderung nach bedingungsloser Kapitulation der Achsen-Gegner - einer Forderung, die in der Kriegsgeschichte neu war und der deutschen Führung genügend Anlaß dafür bot, sich zum >Totalen Krieg< zu entschließen, zur rücksichtslosen Verteidigung bis zum Untergang. Die Endlösung Der deutsche Angriff im Osten hatte sich im Winter 1941 vor Moskau festgelaufen; er war in der Schlammperiode steckengeblieben, die gewöhnlich im Oktober/November einsetzt. Die Wehrmacht erlitt ihren ersten empfindlichen Rückschlag, sie entging nur durch unwahrscheinliche Leistungen an Zähigkeit, Opferwillen und Energie einer Katastrophe. Spätestens ab diesem Zeitpunkt brachen bei Hitler immer häufiger paranoide Vorstellungen durch und wirkten sich auf die Maßnahmen der deutschen Führung aus. … „ S. 467 – 474 Sanssouci Friedrich der Große meinte es ehrlich, als er nach der Unterzeichnung des Kompromisses von Dresden 1745 versicherte, er würde »von nun an keine Katze mehr angreifen, es sei denn, um mich zu verteidigen«. Von der Leidenschaft der Schlachten »bin ich glücklich kuriert; der Rausch ist vorüber«. Mit diesem Tag setzte ein anderer Rausch ein. Der König wollte den Frieden nützen, den er jetzt noch weit dringlicher benötigte als vor drei Jahren. Gleichzeitig nahm er sich allerdings vor, » endlich mein Leben zu genießen«. Gravitätischer, unterlegt mit einem humanistischen Pathos, das nur bedingt ernst gemeint war, drückte er dasselbe mit dem Satz aus: »Alles, was uns bleibt, ist, nach Herzenslust zu philosophieren, im Schatten des Ölbaums die Wissenschaften zu pflegen und an der Veredelung unserer Seelen zu arbeiten.« Die folgenden zehn Jahre gelten als die augusteische Zeit des friderizianischen Preußen: Es ist die Zeit der Tafelrunde von Sanssouci, der Abendkonzerte, des Flötenspielern, der Tischgespräche, aber auch die Zeit, in der Samuel Freiherr von Cocceji mit einer Justizreform beauftragt wurde, die schon in ihrer ersten Phase das Aufsehen der europäischen Staaten erregte. Der König hielt sich an die Richtlinien, die bald nach seinem Regierungsantritt festgelegt worden waren, als er die Folter verbot. Das meiste der Reformen blieb zwar Ansatz, aber selbst als Torso stellte es – sieht man von Österreich ab – weit mehr dar als diejenigen Maßnahmen, die in den vergleichbaren Staaten Europas zur selben Zeit durchgeführt wurden. Mit dem Bau seines Schlosses Sanssouci hatte man schon im letzten Kriegsjahr 1745 begonnen. Zwei Jahre später wurde es bezogen. Seit 1750 wurde Voltaire Gast des Königs, fast volle drei Jahre lang. Keinen Zeitgenossen verehrte Friedrich II. aufrichtiger und niemanden durchschaute er besser als diesen >König der Aufklärung<. Doch auch Voltaire kannte den Preußenkönig sehr genau und beurteilte ihn kritisch und scharf. Die Grobheiten, mit denen sich beide wechselseitig verletzten, waren ungerecht und zutreffend. In den ersten Jahren der Freundschaft genossen sie den gegenseitigen begeisterten Respekt und die deklamatorischen Schmeicheleien sowie die Relativierung ihrer Persönlichkeiten durch das Übermaß. In kürzester Zeit hatte jeder Klarheit über die Beurteilung des anderen gewonnen. Die verehrungsvolle Zuneigung wurde allmählich zur liebevollen Abneigung. So bewunderten und verachteten sie sich bis zum Tod. Friedrich der Große charakterisierte sich einmal selbst mit dem Kürzel: »Philosoph aus Neigung, Politiker aus Zwang. « Es trifft zu, sofern man ergänzt: aus innerem und äußerem Zwang. Die Antithese, um die es dabei ging, wurde von Voltaire exakter gefaßt. Der König sei von einem doppelten Enthusiasmus erfüllt, »dem Enthusiasmus des Denkens und dem des Handelns«. Freilich stand der Reflektierende dem Agierenden ununterbrochen im Weg und umgekehrt. Innerhalb dieser bestimmenden Gegensätzlichkeit war das auffälligste Begriffspaar Friedrichs Gleichmut einerseits und seine Eitelkeit andererseits. Mit vierundzwanzig Jahren, in seinem ersten Brief an Voltaire, versicherte der Thronfolger, »daß die Vorzüge der Geburt und jener Dunst von Größe, in den die Eitelkeit uns einhüllt, nur zu wenigem oder besser gesagt zu nichts dienen«. Die gleiche Überzeugung drückte er ein Jahrzehnt später aus: »Die, welche aus Eitelkeit Großes vollbringen, sind nur zweiten Ranges. « Der Ästhet Friedrich verherrlichte und bewunderte das Heroische und menschlich Exzeptionelle in solchem Übermaß, daß der Verdacht nicht unbegründet erscheint, er wäre nicht zuletzt davon bewogen worden, sich selbst in der Rolle des Helden, des Außergewöhnlichen zu versuchen. Welche Schwierigkeiten jedoch ergaben sich für den Schöngeist, in der politischen und militärischen Wirklichkeit einen Part zuspielender sich wechseln ließ? Die Welt nannte ihn bereits >groß<, begrüßte ihn mit dem »Vivat Fridericus Magnus«, da klagte er noch: » Der Geist der großen Männer ist nicht der meine. « Und doch vereinten sich in ihm: ein genialer Feldherr, ein erfolgreicher Staatsmann, ein passionierter Musiker und Komponist, ein erstaunlich produktiver Dichter, ein angelegentlicher Historiker, ein beflissener Philosoph, ein brillanter Aphoristiker, ein politischer Denker – zuviel für die durchschnittliche Fassungskraft; selbst Voltaire schüttelte den Kopf: »Es ist lächerlich, daß so viele Seelen nur einen Körper haben.« Aber nicht diese Polaritäten bestimmten Friedrichs persönliches Leben, sondern die Schwierigkeit, daß er nichts davon ausschließlich sein konnte. Er hat darunter sehr gelitten, er hat es zugleich sehr genossen. Der König schrieb kaum zu zählende Bemerkungen darüber nieder, hervorragende Belege für eine in sich schlüssige Interpretation seines Wesens und vorzügliche Dokumente für das Gegenteil. Doch gerade im 18. Jahrhundert wurde nichts mit derart starker Überzeugung ausgesprochen wie sittliche Überzeugungen, war nichts so unverbindlich wie diese eindringlichen Bekenntnisse. Was der König zwischen 1746 und 1756 in Sanssouci versuchte, war ein Wiedereinholen der glücklichen Rheinsberger Jahre. Das Ende kam zu rasch, es war enttäuschend, von der Tafelrunde blieb nur ein herber Nachgeschmack. Der Bruch mit Voltaire 1753 fiel zusammen mit der beginnenden Einsamkeit des Königs, einer verabscheuten, gehaßten, weitgehend selbstverschuldeten Einsamkeit. Voltaire schreckte nicht zurück vor den unbarmherzigen Zeilen: » Der Schatz Ihrer Weisheit ist verdorben durch die unselige Freude, die es Ihnen macht, alle anderen Menschen demütigen zu wollen, ihnen verletzende Sachen zu sagen und zu schreiben, eine Freude, die Ihrer um so weniger würdig ist, als Sie durch Ihre Stellung und Ihre einzigartigen Gaben über ihnen stehen. Sie fühlen sicher, daß ich Ihnen die Wahrheit sage. « Friedrich II. war es bewußt, mit welcher Freude sein spitznasiger Intimus, »der unheilvollste und verführerischste Mann von Genie, der je in dieser Welt war oder sein wird«, diese Wahrheit niedergeschrieben hatte. Einkreisung Preußens Im Jahr 1752., da Voltaire an der Tafelrunde von Sanssouci glänzte, verfaßte Friedrich der Große sein erstes Politisches Testament. Darin hieß es: »Ich wünschte, daß wir Provinzen genug besäßen, um 180 000 Mann, also 44 000 mehr als jetzt, zu unterhalten. « Für die Erfüllung dieses Verlangens schienen ihm Gewaltmittel nicht unbedingt erforderlich zu sein; zusätzlicher Landgewinn ließ sich auf friedlichem Weg erreichen. Charakteristisch dabei war jedoch sein Denken in militärischen Einheiten, in jenem speziellen Angriffs- und Verteidigungsschema, dem er selbst durch den schlesischen Überfall eine neue Färbung verliehen hatte. Bis zu seinem Lebensende blieb Friedrich der Große ein Gefangener seiner eigenen Methoden und Bewertungen, seines Mißtrauens und der Befürchtung, die Herrscher Europas wären genauso unzuverlässig und aggressiv wie er selbst- eine Erwartungsneurose, die ihn zu dauernder Angriffsbereitschaft zwang. Daß Preußens Könige »immer auf dem Posten sein müssen, mit gespitzten Ohren, um ihre Nachbarn zu überwachen, und bereit, sich von einem Tag zum ändern gegen die verderblichen Pläne ihrer Feinde zu verteidigen«, das war kein Zeichen innerer Kraft. Durch diese Ausgangslage wurde Friedrich II. zu dem unglückseligsten politischen Fehler seines Lebens verführt. Seit 1746 bestand ein russischösterreichisches Verteidigungsbündnis; potentiell war es gegen Preußen gerichtet. England, das durch seine Kämpfe gegen Frankreich zunehmend in Nordamerika engagiert war, versuchte nun, seinen hannoverschen Besitz durch europäische Allianzen abzusichern. Im September 1755 schloß London mit Petersburg einen Beistandsvertrag. Rußland verpflichtete sich darin, Hannover durch Einsatz von mehr als fünfzigtausend Mann zu schützen. Unterdessen hatte Maria Theresia mit geradezu unsäglicher Geduld versucht, in Paris Verständnis dafür zu wecken, daß Wien den uralten Gegensatz, die quasi natürliche Feindschaft zwischen Österreich und Frankreich, als nicht mehr existent ansehe. Bereits ein Jahr nach dem Frieden von Aachen versicherte sie dem französischen Botschafter, das Gleichgewicht zwischen ihren beiden großen Staaten befinde sich in völligem Einstand, eine bessere Friedensgarantie könne es gar nicht geben. Kaunitz lockerte in Paris unentwegt den Boden in dieser Richtung. Im Jahr 17 5 4 waren Frankreich und England in Nordamerika zu offenem Kampf angetreten. Das hatte England zu seinem Bündnis mit Rußland bewegt, da es einen preußischen Angriff auf Hannover befürchtete. Von Wien verlangte London, daß sofort ein starkes Heer nach den Niederlanden geschickt würde, und Frankreich wiederum drängte Friedrich den Großen dazu, unverzüglich Hannover anzugreifen. Weder Wien noch Berlin reagierten wunschgemäß. Maria Theresia beorderte ein Truppenkontingent in die Niederlande, dessen Stärke kaum mehr als Symbolwert hatte, und Friedrich ließ in Paris mitteilen, wenn er in Hannover einmarschiere, würde Preußen auf der Stelle von einem russischen Riesenheer überschwemmt, worauf die Österreicher im Süden nur warteten. Er könne lediglich aktiv werden, wenn Paris die Osmanen gegen die Kaiserin in Bewegung bringe. Ferner gäbe es noch die Möglichkeit, daß französische Truppen selbst gegen Hannover zum Angriff anträten. Friedrich hatte bei dieser Argumentation unentwegt das Gespenst einer Einkreisung Preußens vor Augen, und zwar so sehr, daß es schließlich durch ihn selbst Gestalt annahm. Denn nach London signalisierte er, daß er sich von der französischen Partnerschaft nichts mehr verspreche; wörtlich: »Frankreichs Alliierter zu sein, heißt Frankreichs Sklave zu sein. « England bat daraufhin den König, sich für den Fall eines französischen Angriffs auf Hannover neutral zu verhalten. Friedrich, gedrängt von seinen Befürchtungen, schloß im Januar 1756 mit London die Westminster-Konvention ab. England und Preußen verpflichteten sich in diesem scheinbaren Defensiv-Papier, die Neutralisierung Deutschlands zu garantieren, das hieß: gegen jeden Einmarsch oder auch nur Durchmarsch fremder Truppen militärisch vorzugehen. Die Vereinbarung hatte in ihren drei wesentlichen Punkten diejenigen Folgen, die Friedrich der Große vermeiden wollte. Er hatte sich erstens erhofft, daß Frankreich seine deutschen Interessen durch die Konvention nicht beeinträchtigt sehen würde. Dies war eine Fehlspekulation, da England die Konvention gerade wegen und gegen Frankreich abschloß. Er hatte zweitens damit gerechnet, daß nach dem Auslaufen des französisch-preußischen Bündnisses im April 1756 Frankreich keinen anderen Bundesgenossen mehr habe als ihn und deshalb nach wie vor auf Preußen angewiesen sein werde. Auch das war eine Fehlspekulation; denn Paris fühlte sich neuerlich betrogen, es reagierte mit höchster Empörung und schloß unmittelbar darauf am i. Mai 1756 mit Österreich ein Defensivbündnis ab, das zur Vorstufe eines Offensivvertrages wurde. Friedrich II. hatte drittens darauf gesetzt, daß England nunmehr Rußland dazu bewegen könnte, seine Haltung Preußen gegenüber zu revidieren, wodurch Österreich ins Hintertreffen geraten würde. Dies war ebenfalls eine Fehlspekulation; denn Petersburg zog sich von seinen Verpflichtungen gegenüber England zurück, als die Westminster-Konvention bekannt wurde. Unverzüglich richtete deshalb Wien eine Anfrage nach Petersburg, ob die Zarin Elisabeth zu einem Krieg gegen Preußen bereit sei; die Hofburg erhielt eine positive Antwort. Mit dieser »vergnüglichsten, alle Hoffnungen übertreffenden Nachricht« sah Staatskanzler Kaunitz das Meisterwerk eines »Umsturzes der Bündnisse« als beendet an, was ihm ohne die engagierte Mitarbeit des Preußenkönigs niemals gelungen wäre. Erst Friedrichs staatsmännische Kurzsicht machte es Österreich möglich, den Ring um Preußen zu schließen; denn auf Grund der Frontstellung Paris-Wien-Petersburg gelang es Kaunitz, auch Sachsen und das Gros der deutschen Fürsten der Koalition zuzuführen, ebenso den König von Schweden. Durch eigene Schuld sah sich Friedrich der Große dazu genötigt, ein drittes Mal aus »zwingenden Präventivgründen« einen Krieg vom Zaun zu brechen. Viele warnten, auch Graf Podewils. Doch der König verhöhnte ihn und zählte ihn seitdem zu den »Erzschäkers, die das Brot nicht wert sind, das man Euch gibt«. Abermals glaubte Friedrich folgern zu müssen: »Es bleibt mir nur mehr übrig, zuvorzukommen, bevor ich überrascht werde. « In Wirklichkeit stand es durchaus nicht fest, ob sich die ringförmigen Allianzen außerhalb Preußens bei Frankreich, Sachsen, den Reichsfürsten, Schweden, Polen und Rußland zu der Vernichtungsbereitschaft steigern lassen würden, wie sie sich in dem österreichischen Programm vom August 1755 ausdrückte, in dem das Ziel formuliert worden war, Preußen aufzuteilen. Friedrichs Folgerung, »zuvorkommen« zu wollen, setzte dies voraus, obgleich Sachsen nicht die geringsten Rüstungsanstrengungen unternommen hatte und keiner der mutmaßlichen Gegner 1756 tatsächlich einen Krieg begonnen hätte, nicht einmal Österreich. Preußens Kanonen waren nicht die >Ultima ratio regis<, wie Kardinal Richelieu mehr als hundert Jahre zuvor auf den französischen Rohren hatte vermerken lassen, sondern sie waren Friedrichs erste Vernunft. Er zerstörte alle diplomatischen Handlungsmöglichkeiten zugunsten des Zwanges zur militärischen Aktion. Im August 1756 überfiel er Sachsen, wiederum ohne Kriegserklärung. Polarstern Deutschlands So begann der zentrale Krieg des 18. Jahrhunderts: der Siebenjährige Krieg, ein Krieg ohne wirkliche Folgerichtigkeit, ohne Nötigung, ohne tatsächlich nachweisliche Bedrohung, ein Krieg allerdings, in dem Friedrich dem Großen weit mehr abgefordert wurde, als er bis dahin gegeben hatte, sei es im Feldlager, sei es in Potsdam, sei es in den Entbehrungen des inneren Aufbaus. Doch was von ihm verlangt wurde, konnte er geben; denn er hatte noch weit mehr in sich selbst zu mobilisieren, als seine Gegner erwarteten. Für Friedrich den Großen war 17 5 6 ein Jahr belangloser Siege. Die Koalition gegen ihn mußte ihre Armeen erst einmal sammeln. 1757 sah sich Friedrichs Heer von einhundertfünfundvierzigtausend Mann einer mehr als doppelten Übermacht von Truppen gegenüber, die aus allen Himmelsrichtungen gegen Preußen anrückten. … „ |
|
[Home] [Bücher] [Herausgeber] [Erhältliche Titel] [Artikel] [Kontakt] |
 Florentinische Politik war seit dem Mittelalter eine Politik, die sich elementar an den Wirtschaftsund Handelsinteressen der Stadt orientierte, das heißt: an einer Anzahl von Kaufmanns- und Bankiersfamilien, die ihren Reichtum und ihre Macht nicht zuletzt durch Kämpfe untereinander zu steigern versuchten. Die bekanntesten Namen waren die Albizzi, Alfani, Bardi, Capponi, Cerchi, Peruzzi, Pitti, Pulzi, Ricci, Ridolfi, Rucellai, Sassetti, Strozzi, Uzzano und die Medici.
Florentinische Politik war seit dem Mittelalter eine Politik, die sich elementar an den Wirtschaftsund Handelsinteressen der Stadt orientierte, das heißt: an einer Anzahl von Kaufmanns- und Bankiersfamilien, die ihren Reichtum und ihre Macht nicht zuletzt durch Kämpfe untereinander zu steigern versuchten. Die bekanntesten Namen waren die Albizzi, Alfani, Bardi, Capponi, Cerchi, Peruzzi, Pitti, Pulzi, Ricci, Ridolfi, Rucellai, Sassetti, Strozzi, Uzzano und die Medici.
